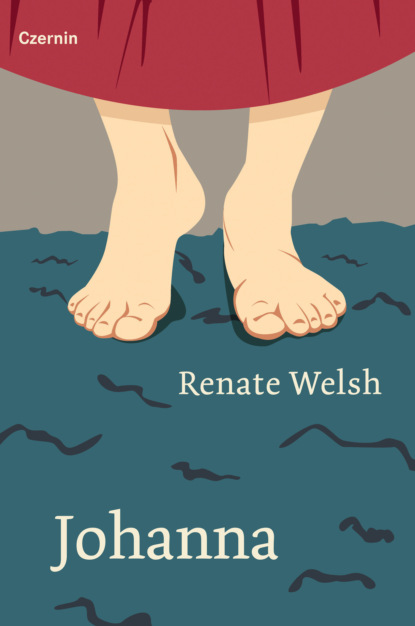
Полная версия:
Renate Welsh Johanna
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Die Bäuerin rief nach Johanna.
Der Briefträger, der gegen Mittag kam, behauptete, er hätte Gundl im Wald verschwinden gesehen. Sie hätte ein Paket getragen.
Die junge Murer durchsuchte alle Schränke und Truhen, konnte aber nicht feststellen, dass irgendetwas gefehlt hätte.
»Du kennst doch den Briefträger!«, sagte sie zur Bäuerin. »Um die Zeit ist der längst voll.«
Eine halbe Stunde später kam Gundl tatsächlich mit einem Paket im Arm die Dorfstraße herunter. Sie drehte die Füße noch mehr einwärts als sonst und ging sehr schief. Das Paket war offensichtlich schwer.
Die junge Murer stürzte aus dem Haus.
»Wo warst du?« Sie gab Gundl eine klatschende Ohrfeige.
»Die alte Frau hat mich geschickt.«
»Die hat dich nirgendshin zu schicken! Wir tragen die Verantwortung für dich!« Wieder eine Ohrfeige.
Gundl begann zu weinen. »Sie hat gesagt, ich darf nichts sagen und ich muss gleich gehen.«
In dem Paket war himmelblaue Atlasseide. »Wie die Fatima-Muttergottes«, erzählte Gundl später auf dem Hochstand. »Sie hat gesagt, sie will sie noch sehen, die Seide für den Sarg, weil sie sie sonst doch nur auf das nackte Holz legen oder höchstens auf ein altes Leintuch.« Sie erzählte auch, die alte Murer hätte vor Freude geweint, als sie den Stoff sah, und hätte immer mit den Fingern darübergestrichen.
Am Abend, als der junge Murer vom Feld heimkam, hörte man Gundl schreien. Am nächsten Tag hatte sie eine neue blutunterlaufene Strieme auf der Wange. Die Striemen auf dem Rücken zeigte sie den Mädchen erst am Sonntag, da waren sie schon verschorft. Drei Tage später starb die alte Murer. Sie hatte die Finger in die blaue Seide verkrampft, der Stoff musste gebügelt werden, bevor man den Sarg damit ausschlagen konnte. Es blieb eine Menge übrig.
Frau Faßbinder und die alte Kirchenvaterin halfen der jungen Murer, die Tote zu waschen und ihr das Hochzeitskleid anzuziehen, Gundl musste Wasser zutragen, sie fürchtete sich, bis sie endlich doch einen Blick auf die Tote warf. Dann legte sich ihre Furcht und sie begann zu weinen.
Am ersten Abend ging die Bäuerin selbst zum Rosenkranz, am zweiten Abend schickte sie ihre Tochter und Johanna in das Trauerhaus. Maria ging bis zum Tor des Murerhofes mit. Aus den Fliederbüschen an der Ecke tönte ein Pfiff.
»Ich komm dann später«, sagte Maria und verschwand.
Johanna ging mit klopfendem Herzen in die gute Stube.
An der Tür reichte ihr eine alte Frau, die sie nie zuvor gesehen hatte, einen Zweig vom Lebensbaum und einen Weihbrunnkessel. Johanna wusste nicht recht, was sie tun sollte, bis ihr die Alte bedeutete, sie müsse den Sarg besprengen.
In der Stube saßen acht oder neun Frauen, der Kirchenvater und der alte Maierhofer, in der Fensterecke hockte Gundl zwischen Romana und Annerl. Romanas Mundwinkel zuckten, als Johanna dastand und nicht wusste, was man nun von ihr erwartete. Die Alte kam ihr wieder zu Hilfe und flüsterte: »Verabschieden gehst dich.«
Johanna trat zum Sarg.
Die alte Murer lag auf der himmelblauen Atlasseide, die Hände über dem Brautkleid gefaltet. Das kleine Gesicht trug einen Ausdruck, als wollte sie loskichern über etwas, was außer ihr niemand wusste.
»Gegrüßet seist du, Maria«, murmelten die Frauen.
Johanna setzte sich neben Annerl.
Links und rechts vom Sarg brannten vier hohe Kerzen. Die Kerzen und die Menschen machten den Raum warm.
Gundls Schultern zuckten.
»Der für uns mit Dornen gekrönt worden ist«, betete der Kirchenvater vor.
Die gemurmelten, immer wiederholten Gebete, das Starren in die flackernden Kerzenflammen machten dösig.
Johanna schreckte hoch, als die Tür aufging.
Der junge Murer verteilte Tee und Semmeln.
Zuerst flüsterte jeder nur mit seinem Nachbarn, dann wurden die Gespräche lauter. Eine Frau lachte, hielt sich die Hand vor den Mund, später lachten mehrere. Nur Gundl schluchzte immer noch. »Wir haben das Kleid hinten aufschneiden müssen«, erzählte Frau Faßbinder, »sonst hätten wir sie nicht hineingekriegt, nicht in der Mitte. Kein Wunder, wenn man sieben Kinder gehabt hat. Aber wir haben es wieder zugenäht, soweit es eben gegangen ist.«
»Sonst müsste sie es bei der Auferstehung zuhalten«, sagte eine.
»Geh, da bekommen sowieso alle neue«, erklärte Frau Kirnbauer.
»Neue und schönere.«
Die junge Murer, die jetzt bald nur mehr die Murer genannt werden würde, fuhr Gundl an: »Heul nicht!«
Gundl nickte, schluckte und schluchzte weiter.
Die junge Murer wandte sich ab.
Die zahnlose alte Frau, die neben der Faßbinder saß, erzählte eine kaum verständliche Geschichte von einem Tanzabend, als sie und die alte Murer jung gewesen waren: »… einfach rausgestiegen ist sie, hat sie mit dem Fuß weggestoßen und weitergetanzt …«
In das Gelächter sagte der Kirchenvater: »Lasset uns beten.«
Gundls Kopf sank auf Johannas Schulter. Im Halbschlaf zog sie durch die Nase auf. Der Schorf auf ihrer Wange sah aus, als würde er bald abfallen.
»Du Turm Davids
Du elfenbeinerner Turm
Du goldenes Haus …«
Der Kirchenvater streckte beim Sitzen sein Holzbein zur Seite. Sein mageres, zerfurchtes Gesicht war tief über die gefalteten Hände mit den dicken, rotblauen Knöcheln gebeugt. Er wurde Kirchenvater genannt, weil sein Vater die Kapelle gebaut hatte, zusammen mit seinen drei Söhnen und einem Maurer. Er habe es zur Sühne getan, hatte Romana erzählt, wofür, wusste sie nicht, Hemma hingegen hatte gesagt, es sei ein Gelübde gewesen.
Die junge Murer hatte einen verkniffenen Mund, ihre Augen wanderten beim Beten herum; als sie Johannas Blick auffing, schüttelte sie streng den Kopf.
Zum ersten Mal betrachtete Johanna die Gesichter in Ruhe und aus der Nähe. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass sie in etwas hineingezogen wurde, aus dem sie sich heraushalten wollte. Sie betrachtete ihre eigenen Hände. Die schwarzen Rillen an Fingerspitzen und Knöcheln waren so eingefressen, dass sie nicht einmal mehr ganz verschwanden, wenn Johanna zwei Tage lang Wäsche wusch.
Das Gemurmel wurde dünn. Einer nach dem anderen nickte ein. Annerl schnarchte leise, atmete pfeifend ein, betete ein paar Sätze mit, schnarchte wieder. Sie hatte eine ewig verstopfte Nase. Der Murer brachte Birnenschnaps.
»… vor der Kirche, so wahr ich hier stehe …«
»… was das für eine ist …«
Nicht einmal das Ausrichten anderer Leute konnte alle aus ihrer Schlaftrunkenheit aufrütteln. Die Kerzen flackerten.
»Noch einen schmerzensreichen Rosenkranz und dann gehen wir«, sagte Frau Faßbinder.
Stellenweise betete der Kirchenvater allein. Seine Frau war neben ihm eingeschlafen, den Kopf auf die gefalteten Hände gebettet.
Als sie aus dem Haus traten, waren Mond und Sterne verschwunden. Nur aus der Tür fiel ein Lichtkegel auf die Dorfstraße.
Johanna ging schnell. In den Büschen hinter dem langen Murer-Zaun raschelte und knisterte es. Die Bäume knarrten.
Plötzlich sah sie das Gesicht der Toten hoch über den schwarzen Bäumen.
Sie rannte los.
»Johanna!«, rief es hinter ihr.
Ihre Beine rannten weiter.
Ihre Schulter wurde gepackt.
»Spinnst du? Wir müssen miteinander heimkommen.«
Es war nur Maria. Sie keuchte vom Laufen.
Im Hoflicht sah Johanna, dass Marias Haar aufgelöst über ihre Schultern hing. Sie sah ganz anders aus als sonst.
Maria deutete mit dem Kopf zum Haus. »Du sagst sowieso nix?«
Johanna nickte.
Die Ziegel für ihre Betten lagen auf der Herdplatte. Sie waren noch heiß.
Johanna trug erst den einen, dann den anderen mit der Zange in die Kammer und fuhr mit den heißen Ziegeln über die klammen Betttücher. Der Zementboden war so kalt, dass sie nur auf Zehenspitzen gehen konnte.
Als sie im Bett lag, sah sie wieder das tote Gesicht mit dem seltsam kicherbereiten Mund.
Maria drehte sich mit einem Seufzer im Bett um.
Johanna zog die Tuchent über den Kopf.
Der Brief
Johanna schlichtete Holz in die Ofenlade, dann heizte sie nach.
Das Wasser für den Sautrank kochte noch immer nicht. Der Herd zog schlecht, wenn der Nebel dick über dem Tal lag.
Gustl kam in die Küche und griff nach einer der Kaffeetassen, die am Herdrand standen.
»Nicht die«, sagte seine Mutter. »Der ist von gestern, der gehört für die Dirn.«
Ein Ast klemmte im Ofen. Johanna hieb mit dem Schürhaken darauf, bis er endlich in die Glut rutschte.
Die Bäuerin schüttelte den Kopf.
Johanna goss kochendes Wasser über den Schrot im Eimer, rührte um und trug den Sautrank in den Stall.
Die vier Säue hoben die Köpfe. Ihre kleinen Augen funkelten böse. Vor der großen Alten hatte Johanna Angst. Die hatte schon ein paar Mal nach ihr geschnappt. Wenn man die lange, spitze Schnauze mit den mahlenden Kiefern ansah, die wässrigen Augen unter den weißen Wimpern, die so listig an einem vorbeiblickten, dann konnte man die Geschichten glauben von Schweinen, die Säuglingen die Beine abgefressen haben sollten. Sie holte die Mistgabel und begann die Koben zu säubern, während die Säue mit dem Fressen beschäftigt waren.
Maria war noch nicht vom Milchausführen zurück. Die hatte sicher wieder auf dem Heimweg ihren Franz getroffen.
Vor ein paar Tagen war Franz am Abend in die Kammer gekommen und hatte Johanna fünfzig Groschen gegeben, damit sie in die Küche ging. Johanna hockte dort im Finstern auf der Ofenbank und hörte nebenan Kichern und Keuchen. Eine Zeit lang überlegte sie, ob sie zur Tür schleichen und hineinspähen sollte. Gleichzeitig schämte sie sich ihrer Neugier. Die fiel jedenfalls unter das sechste Gebot, das war sicher. Sie wusste nur nicht mehr, was zu diesem Punkt im Beichtspiegel gestanden war. Aber der war in der Schule geblieben, er hatte ja der Schülerlade gehört. In die Kirche konnte sie sowieso nicht gehen, ohne Schuhe.
Sie schlief auf der Ofenbank ein und wachte erst auf, als Franz schon gegangen war und Maria sie rüttelte. Am Morgen versteckte sie die fünfzig Groschen unter ihrer zweiten Unterhose im Schrank auf dem Speicher. Eines Tages, wenn sie Schuhe hatte, würde sie mit Romana und den anderen Mädchen in Gloggnitz oder in Grafenbach ins Kino gehen. Das Eintrittsgeld hatte sie ja jetzt.
Unsinn. Sie hatte gar nicht die Absicht, hierzubleiben. Es fiel ihr immer schwerer, daran zu glauben, dass sie jemals anderswo gewesen war, dass sie jemals anderswo sein würde. Ihre Füße gingen automatisch, wohin man sie schickte, ihre Hände fanden im Dunkeln Werkzeug und Küchengeräte.
Johanna lief über den Hof ins Haus zurück. Der Nebel hatte die Steine mit einer feinen Eisschicht überzogen. Jeder Schritt tat weh. Sie musste die Bäuerin um ein Paar alte Stiefel bitten, obwohl sie wusste, was für ein Gesicht die Bäuerin machen würde. Der alte Kaffee schmeckte säuerlich.
Maria kam erst zurück, als der Bauer schon bei der Vormittagsjause saß. Er schnitt ein Stück Selchfleisch ab, zeigte mit dem Messer auf seine Tochter. »Wo hast du dich wieder herumgetrieben?«
Maria warf den Kopf zurück. »Milchausführen dauert seine Zeit. Wenn es dir nicht passt, kannst du die Milch an die Molkerei verkaufen. Da bekommst du nicht ganz die Hälfte.« Sie hatte eine Art, ihre Eltern anzusehen, vor der sogar der Bauer verstummte. Nächstes oder übernächstes Jahr würde sie ihren Franz heiraten, sobald der alte Gruber übergeben hatte. Maria wollte nicht auf den Hof der Schwiegereltern ziehen, solange Franz seinem Vater noch den Großknecht machte. Seit vier Jahren versprach Gruber in jedem November, im nächsten Januar zu übergeben, und in jedem Januar fand er einen Grund, warum es noch nicht möglich war. Maria sammelte inzwischen Bettwäsche und Tischtücher in ihrer Truhe. Sie war auf einer landwirtschaftlichen Schule gewesen und stickte wunderschöne Monogramme in rotem Kreuzstich in jedes Stück. M L – Maria Lahnhofer. Manchmal stickte sie ein flammendes Herz Jesu dazu, manchmal eine Blume. Franz sagte: »Warum stickst du nicht gleich M G, du wirst doch Maria Gruber heißen.« Maria stickte weiter M und L, jeden Sonntag nach dem Essen, bevor sie mit Franz spazieren ging.
Die Bäuerin bemerkte erst beim Kochen, dass ihr der Zucker ausgegangen war. Sie reichte Johanna den Schlüsselbund und schickte sie auf den Speicher. Dort gab es eine zementierte Kühlkammer, die in den Boden eingelassen war. Anstelle einer Tür hatte sie einen mit Fliegengitter bespannten Eisenrahmen, an dem ein Schloss hing. Die Kühlkammer war angefüllt mit Selchfleisch, Bratwürsten und Speck. Johanna hatte nur dann eine Bratwurst bekommen, wenn sie angeschimmelt war. Sie sperrte auf, riss drei Paar Bratwürste von den hintersten Haken, warf die Bratwürste in ihren Schrank, sperrte die Kühlkammer zu und füllte den Eimer mit Zucker.
Später lief sie in einem unbeobachteten Augenblick noch einmal hinauf, um die Würste hinter einem losen Brett zu verstecken.
Da waren sie sicher. Sie würde die Würste beim Kuhhüten essen, und der Bäuerin geschah ganz recht.
Als das Mittagessen auf dem Tisch stand, kam der Briefträger. Er ging in die Küche. Die Bäuerin holte die Schnapsflasche. »Ist gar nicht für dich«, sagte der Briefträger. »Der Brief ist für eure Dirn.« »Trink trotzdem«, sagte die Bäuerin und nahm den Brief.
Johanna schluckte mehrmals, bis sie herausbrachte: »Das ist mein Brief.«
Der Bauer legte den Löffel weg. »Was hast du gesagt?«
»Dass das mein Brief ist!«
»Soso. Dein Brief.« Der Bauer beugte sich drohend vor. »Hat wer gesagt, dass es nicht dein Brief ist?«
Johanna streckte die Hand aus.
»Erst wird gegessen«, sagte der Bauer.
Die Wut würgte Johanna. Jeder Bissen wurde im Mund immer mehr, ein widerlicher Brei. Sie hustete und spürte die Blicke der anderen.
Endlich war ihr Teller leer.
Sie trug das schmutzige Geschirr zum Waschschaff. Der Bauer machte noch immer keine Anstalten, ihr den Brief zu geben.
Maria stand auf, nahm ihrem Vater wortlos den Brief weg und reichte ihn Johanna.
Johanna lief in den Stall, hockte sich neben Resi, die sanfteste von den Kühen, und steckte ihre kalten Zehen unter den warmen braunen Bauch. Dann riss sie das Kuvert auf.
Ein Brief von ihrem Vater. Sie hatte nicht mehr damit gerechnet, dass er antworten würde.
»… und kann ich dir nicht sagen«, schrieb er, »warum ich deine Mutter damals nicht geheiratet habe. Da müsste man reden.
Komm doch her, hier ist Platz. Deine Halbschwestern sind zwölf, elf und neun. Der Sohn ist zwei Jahre alt.«
Ich habe also Geschwister, dachte Johanna. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, die sieben Kinder, die ihre Mutter mittlerweile geboren hatte, als ihre Geschwister zu bezeichnen. Das waren die anderen Kinder ihrer Mutter. Mit ihr hatten sie nichts zu tun. Ob die Geschwister von ihr wussten?
Der Vater wollte sie zu sich nehmen! »Dein treuer Vater«, schrieb er.
Aber er hatte vierzehn Jahre lang nicht nach ihr gefragt. Und wenn sie hinfuhr, dann musste sie dort bleiben.
»Johanna!«, rief die Bäuerin.
Johanna steckte den Brief in die Schürzentasche und rannte in die Küche.
»Glaubst du, das Geschirr wäscht sich von allein? Wenn du da fertig bist, mach den Hühnerstall sauber.«
Während Johanna Pfannen schrubbte und Teller wusch, während sie den Stall fegte und Hühnerdreck von der Leiter kratzte, versuchte sie nachzudenken. Ihre Gedanken gingen immer im Kreis. Schon das Wort »Vater« war ihr fremd. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie das war, wenn man einen Vater hatte. Zum Pflegevater hatte sie nie »Vater« gesagt, sie hatte es vermieden, ihn direkt anzureden. Er war immer weit weg gewesen, auch wenn er oben am Tisch saß, zwischen der Pflegemutter und Maria. Der anderen Maria.
Sie sah den Tisch vor sich, den Tisch und die weißen Tassen mit der goldenen Schrift.
Warum antwortete die Pflegemutter nicht auf ihren Brief?
Die Hühner gackerten aufgeregt herum, Federn flogen. Johanna bekam eine winzige Flaumfeder in die Nase.
Als Romana am Hoftor vorbeiging – sie war in diesem Monat zum Läuten an der Reihe –, lief Johanna hinaus.
»Hast du Zeit?« Romana nickte eifrig. »Nach dem Läuten, ja. Ich warte im Holzschuppen auf dich. Ist was?«
»Ich sag’s dir dann.«
Als die Glocke anschlug, tat es Johanna schon leid, dass sie ausgerechnet Romana ins Vertrauen hatte ziehen wollen. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit Maria zu reden? Aber Maria war die Tochter des Bauern, trotz allem.
Die Bäuerin war in die Stadt gefahren, der Bauer hatte Amtstag als Armenrat und hinterher ein Treffen der Freiwilligen Feuerwehr. Johanna hatte am Morgen seine Uniformhose ausgebürstet und gebügelt. Es bestand also kein Grund, nicht hinauszugehen und mit Romana zu reden. Maria sagte sicher nichts.
Als die Glocke verklungen war, ging Johanna mit dem leeren Holzkorb in den Schuppen. Romana wartete schon.
»Was ist los? Du kannst mir ruhig alles sagen.« Sie betonte das »alles«, setzte sich auf einen Baumstrunk und sah Johanna erwartungsvoll an. Johanna suchte nach einem Anfang. Romana zeichnete mit einem Zweig ein R nach dem anderen in die Sägespäne auf dem Boden.
Als Johanna endlich doch von dem Brief erzählt hatte, schüttelte Romana energisch den Kopf. »Das ist nichts. Du bist dort ja doch bei fremden Leuten. Wer weiß, ob die Stiefmutter dich anerkennt.«
»Hier bin ich auch fremd.«
»Hier hast du uns. Dort hast du keinen.«
Hier auch nicht, dachte Johanna.
»Ich bin doch deine Freundin«, fuhr Romana fort.
»Dort hätte ich Geschwister.«
Romana winkte ab. »Das ist nichts. Ich habe eine gekannt, die war bei ihrem Vater. Sie ist weggerannt, und dann haben sie sie mit der Gendarmerie zurückgebracht. Zum Schluss ist sie in ein Narrenhaus gekommen.«
»Er schreibt, er will mit mir reden«, sagte Johanna.
»Papier ist geduldig.« Romana sprach plötzlich Hochdeutsch, wie immer, wenn sie etwas nachsagte, was sie von Frau Berger gehört hatte. »Hat er sich um dich gekümmert? Siehst du. Du wärst schön dumm, wenn du gingst.«
Es war finster im Schuppen, nur Romanas Gesicht hob sich als heller Fleck von der Dunkelheit ab. Im Grabenwald unten schrie ein Käuzchen.
»Ich muss rein«, sagte Johanna. »Ich glaube, sie rufen mich.« Romana stand auf. »Morgen komm ich wieder, ja? Mach keinen Unsinn.«
»Ich weiß nicht, ob ich morgen kann.«
Jetzt rief Maria wirklich.
Johanna lief über die Straße. Maria fragte nicht, wo sie gewesen war. Sie gingen miteinander in den Stall.
Nach dem Melken las Johanna den Brief noch einmal in der Milchkammer, und später, als die Familie längst zurück war und alles in der Küche wieder an seinem Platz stand, ging sie hinaus in den Hof und las ihn noch einmal im Licht der Hoflampe. Der Knecht kam vorbei auf seinem Weg in den Stall, wo er neben dem Pferd schlief.
»Hast vielleicht einen Liebesbrief?«
»Bist blöd?«
Sie konnte den Brief jetzt auswendig. Aber das half ihr nicht zu erkennen, was hinter den groß und steil geschriebenen Wörtern stand.
Am nächsten Tag war Kirtag in Neunkirchen.
»Wenn sie Schuhe hätte, könnte sie mitkommen«, sagte die Bäuerin zu Maria.
»Sie kann meine braunen haben.«
»Die braunen? Die sind doch erst ein Jahr alt!«
Johanna räusperte sich vor der Tür, bevor sie in die Küche ging. Auf eine seltsame Art störte es sie, dass Maria für sie Partei ergriff.
»Du kannst die Kühe austreiben, wenn du sowieso da bist«, sagte die Bäuerin. Sie hatte Johanna ein Paar alte Stiefel geschenkt. Das Loch im rechten war mit Leukoplast verklebt. Johanna zerriss einen Fetzen, den sie auf dem Speicher gefunden hatte, in schmale Streifen und wickelte die Streifen um ihre Füße, bevor sie in die Stiefel stieg. Mit den Fetzen rutschte sie nicht so weit vor und stieß sich nicht die Zehen wund. Ihre Strümpfe wollte sie nicht zum Hüten anziehen. Die hob sie auf. Wenn sie von hier wegging, würde sie sie anziehen. Die Strümpfe und die blaue Schürze, in deren Tasche das Fahrgeld eingenäht war.
Sie nahm im Vorübergehen ein Paket Zündhölzer aus der Küche mit, steckte ein Paar von den gestohlenen Bratwürsten in die Tasche und trieb die Kühe auf die Wiese vor dem Grabenwald.
Hier lagen überall Föhrenzapfen. Sie sammelte eine Schürze voll, dann holte sie Steine aus dem Wald und baute eine richtige Feuerstelle. Das dürre Gras ließ sich leicht anzünden. Sobald das Feuer heruntergebrannt war und alle Zapfen rot glühten, spießte sie die erste Wurst auf einen Zweig und hielt sie über das Feuer. Sie sah zu, wie das Fett hinuntertröpfelte und kleine Stichflammen aufschossen, drehte die Wurst langsam und gleichmäßig und behielt dabei den Fuhrweg zum Dorf im Auge. Wenn jemand kommen sollte, hätte sie immer noch Zeit, die Wurst verschwinden zu lassen. Sie zwang sich zu warten, bis die Haut rundherum braun und glänzend war.
Eigentlich hatte sie hier ständig Hunger. Daheim war sie gewöhnt gewesen, zwischendurch ein Stück Brot abzuschneiden oder einen Apfel aus dem Keller zu holen. Die Zeit zwischen den Mahlzeiten wurde ihr lang, obwohl sie beim Essen Brot und Erdäpfel nehmen konnte, so viel sie wollte. Bei Fleisch und Mehlspeisen war es anders.
»Fleisch macht hitzig«, sagte die Bäuerin. »Und wir tragen die Verantwortung.«
Johanna biss in die Wurst und verbrannte sich dabei den Mund. Weil sie gestohlen ist, dachte sie.
Später warf sie noch einmal Zapfen in die schwach glosenden Reste des Feuers und wärmte sich die Hände. Die Kühe waren friedlicher als sonst, nur der Bless musste sie wieder einmal nachlaufen, bis sie Seitenstechen bekam.
Als sie die Kühe heimtrieb, spielten die Dorfbuben auf der Straße Fußball. Josef und Gustl waren auch dabei.
Sie führte die Kühe in ihre Boxen und legte sie an die Eisenketten. Die Schweine grunzten; die große Sau war besonders unruhig, trampelte in ihrem Koben auf und ab, rieb sich an der Holzwand. Während Johanna die Resi säuberte, drehte die ihr plötzlich den Kopf zu und fuhr ihr mit der Zunge über die Haare, bis zum Ohr herunter.
Maria kam und begann zu melken.
Als Johanna ins Haus trat, stand der Bauer auf, packte sie am Arm und führte sie hinaus auf die Straße. Er zeigte auf den Holunderstrauch vor dem Holzschuppen.
»Weg willst du?«, fragte er. »Weg willst du? Da! Wenn du herbrunzt, wird’s noch nass sein, und du bist schon zurück. So gut wie hier geht’s dir nirgends. Krieg das endlich in deinen Kopf.« Johanna schnappte nach Luft.
»Bekomm ich keine Antwort?«, fragte er.
Sie hätte nicht reden können, selbst wenn sie gewollt hätte.
Er ließ sie plötzlich los, drehte sich um und ging ins Haus. Johanna blieb stehen.
Sie wäre am liebsten hinübergelaufen zur gelben Villa am Dorfrand und hätte Romana zur Rede gestellt. Aber das hatte ja doch keinen Sinn. Romana würde alles abstreiten.
Johanna verkroch sich ins Bett. Sie zog die Beine an, umschlang sie mit den Armen, igelte sich ein. Ihre Kehle brannte, ihre Augen brannten. So ist das, flüsterte sie in ihre Knie. Du hast eben niemanden.
Aber der Vater hatte geschrieben: Komm!
Als was? Als Tochter? Oder als Dirn?
Die Ziehmutter hatte immer gesagt: Überschlafen wir es erst. Wenn der Vater sie wirklich zu sich holen wollte, würde er noch einmal schreiben.
Plötzlich fiel Johanna die weiße Katze daheim ein. Die hatte inzwischen längst schon ihre Jungen. Wenn die Ziehmutter sie rechtzeitig gefunden hatte, waren sie sicher ertränkt worden. Aber die Weiße war geschickt, die versteckte ihre Jungen gut. Und wenn sie dann mit richtigen jungen Katzen anmarschiert kam, hatte die Mutter nicht mehr das Herz, sie wegzuräumen. Mit den nackten, hässlichen Neugeborenen war das anders. Die weiße Katze war Johanna oft nachgelaufen, wenn sie im Gemüsegarten gearbeitet hatte, und hatte ihr zugesehen mit ihren grünen Augen.
Ob den Becher mit »Johanna« darauf jetzt ein anderer verwendete? Oder verstaubte der hinten in der Kredenz?
Johanna gab sich einen Ruck.
Irgendwann zeig ich es ihnen.
Irgendwann wird alles anders.