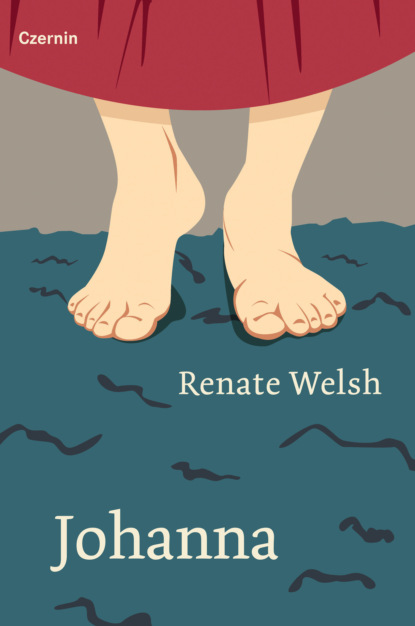
Полная версия:
Renate Welsh Johanna
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Eine Frau verlangte schrill, die Beschließerin müsse zuerst von ihrem Kaffee trinken. »Die wollen mich vergiften«, flüsterte sie. Die Beschließerin nahm einen Schluck, als sei das jeden Morgen so, dann brockte die Frau ihr Brot in die Tasse und begann genießerisch zu schlürfen.
Johanna lehnte Kaffee und Brot ab.
»Ich hab meine Vorschriften«, sagte die Beschließerin.
Johanna stand auf und ging zum Waschbecken. Während sie sich wusch, spürte sie Blicke auf ihrem Rücken. Jemand kicherte. Johanna flocht ihre Zöpfe neu und setzte sich wieder auf ihr Bett. Eine alte Frau schlurfte zwischen den Betten hin und her, brachte einer Bettlägerigen einen feuchten Waschlappen, fütterte eine andere, kämmte eine dritte.
Johanna wartete.
Die Tür ging auf. Es war nur eine Frau mit Eimer und Besen, die eine scharf riechende Lauge über den Steinboden schüttete und hin und her wischte.
Gegen acht Uhr kam die Beschließerin wieder und führte Johanna in die Kammer neben dem Tor. Auf dem Weg über den hallenden Gang wiederholte sie: »Ich hab meine Vorschriften.«
In der Kammer saßen zwei Männer, beide die Ellbogen auf den Tisch gestützt, und unterhielten sich laut über ein neues Spritzenhaus für die Feuerwehr. Als die Beschließerin Johanna vor sich her über die Schwelle schob, unterbrachen sie das Gespräch.
»Da hast du deine neue Dirn«, sagte der eine.
Dirn? Hatte er Dirn gesagt?
Der Größere stand auf und trat neben Johanna. Sein Atem roch schal. Er packte ihren Oberarm.
»Mager, aber zäh«, sagte er zufrieden.
»Na, siehst du«, sagte der andere, als hätte er eine Leistung vollbracht. Sein Lächeln war schmierig.
Johanna holte tief Atem. »Ich will Schneiderin werden«, hörte sie sich sagen. »Das haben sie mir versprochen.«
Die beiden Männer wechselten Blicke. »Versprochen? Dir?«
»Ja. Darum bin ich hergekommen.«
Der Große machte eine ungeduldige Handbewegung und sagte zu dem Dicken, der sich kichernd die Hände rieb: »So weit kommt’s noch.« Er wandte sich an Johanna: »Du kommst zu mir als Dirn, damit du es nur weißt.«
»Nein!«
Der Dicke legte die Stirn in Kummerfalten. »Du hast hier nicht zu schreien, verstanden?«
Johanna gab sich einen Ruck. »Ich bleibe nicht da. Ich fahr heim. Die Mutter hat mir sowieso das Fahrgeld eingenäht.«
Die Beschließerin legte Johanna die Hand auf die Schulter und murmelte beschwörend: »Nicht, Mädel, nicht, du machst es dir nur noch schwerer.« Johanna schüttelte die Hand ab, hob den Kopf und sah dem Großen voll ins Gesicht.
Dem stieg unter dem Bartschatten die Röte über die Wangen. Er begann zu brüllen.
»Du wirst hier überhaupt nicht gefragt, verstanden? Du bist meine Dirn und sonst nichts!«
»Herr Armenrat …«, begann die Beschließerin, aber niemand beachtete sie.
Der Dicke verschränkte die Arme. »Das wäre ja noch schöner, wenn ledige Kinder schon was wollen dürften!« Plötzlich schoss seine runde rosarote Hand vor. Johanna wich zurück. »Merk dir eines: Du tust, was man dir sagt, verstanden? Eine wie du hat nicht frech zu sein, sonst …« Die Drohung blieb in der Luft hängen. Nach einer Weile fügte er hinzu: »Du weißt vielleicht gar nicht, wie viele froh wären, überhaupt eine Stellung zu finden. 300.000 und mehr! Und wenn du Ärger machst, nehmen wir dir das Geld weg, hast du gehört?«
Johanna klammerte beide Hände um die Schürzentasche.
»Zerdrückst die schöne Schürze«, murmelte die Beschließerin.
Der Große zog eine goldene Uhr aus der Tasche, ließ sie aufschnappen, runzelte die Stirn und reichte dem Dicken die Hand. »Also wir gehen. Und wegen dem Spritzenhaus reden wir noch.« Er steckte der Beschließerin eine Münze zu, die sich knicksend bedankte, packte Johanna am Arm und führte sie hinaus.
Die Sonne blendete Johanna, als das Tor aufging.
Vor dem Haus stand ein starker, glänzender Brauner vor einem Leiterwagen. Der, der das Pferd hielt, war sicher der Knecht. Er musterte Johanna grinsend.
»Ferdl«, sagte der Bauer, »die ist nichts für dich, die ist erst dreizehn und ich trag die Verantwortung. Merk dir’s.« Ferdl sprang auf den Wagen.
»Du wirst sehen«, sagte der Bauer während der Fahrt, »es ist zu deinem Besten. Es tut nie gut, wenn man sich überhebt über seinen Stand.«
Johanna antwortete nicht. Sie hätte kein Wort herausbringen können, selbst wenn sie gewollt hätte.
Als der Bauer sagte: »Wisch dich ab«, merkte sie, dass sie sich die Unterlippe blutig gebissen hatte.
Das Pferd bog unaufgefordert rechts in eine Seitenstraße ab, die durch den Wald bergauf führte. Ein Eichhörnchen rannte über den Weg. Eine Kastanie polterte auf die ratternden Bretter.
In einer Kehre sah Johanna plötzlich den Berg wieder.
Gleich darauf stand neben der Straße die Ortstafel.
Sie bogen links ab, fuhren an ein paar geduckten Häusern vorbei, Ferdl sprang vom Wagen, öffnete ein Tor.
»Da sind wir«, sagte der Bauer.
Ein großer, braun-weiß gefleckter Hund bellte, seine Kette rasselte, er versuchte, Johanna anzuspringen.
Ferdl lachte. »Der Rolfi tut dir nichts.«
Er spannte das Pferd aus und führte es in den Stall. Der Bauer ging auf das Haus zu; nach ein paar Schritten wandte er sich um und winkte Johanna, ihm zu folgen.
Die Küche war dunkel und sehr heiß. Die Bäuerin rührte in einem großen Topf. Johanna konnte ihr Gesicht nicht sehen. Der Bauer verlangte ein Glas Most.
Die Bäuerin seufzte, nahm einen Krug und sagte im Vorübergehen zu Johanna, sie käme gerade recht, sie solle gleich die Bohnen auslösen. Der Korb stünde auf der Bank.
Johanna stellte den Pappkarton mit ihren Sachen in die Ecke. Sie hatte bald die Hand voll Bohnen und wusste nicht, wohin damit. »Worauf wartest du?«, fragte die Bäuerin, die mit dem Most zurückkam.
»Wo ich sie reintun soll.«
Mehr zu sich selbst als zum Bauern oder zu Johanna murmelte die Bäuerin: »Es ist ein Jammer. Sie werden immer dümmer.« Sie nahm einen großen irdenen Topf vom Regal neben dem Herd. Johanna machte sich an die Arbeit.
Ich bleibe sowieso nicht. Ich bleibe nicht. So war es nicht ausgemacht. Ich bleibe nicht.
Daran klammerte sie sich, während sie die fleckigen Bohnen aus den Schoten löste. Der Bauer schnitt Brot und Selchfleisch, trank seinen Most und aß schweigend. Dann ging er.
Die Bäuerin schlug Knödelteig ab.
Eine Uhr tickte. Eine Fliege stieß gegen die Fensterscheibe, surrte durch die Küche, bis die Bäuerin ein Tuch nahm und sie erschlug. In der Nähe schlug eine Glocke an, hoch und schnell. Die Bäuerin warf die Knödel ins aufzischende Wasser. »Bist du noch immer nicht fertig? Hol eine Kanne Wasser.«
Johanna ging mit der hohen braunen Kanne über den Hof. Rolfi bellte wie verrückt. Man musste lange pumpen, bis Wasser kam. Johanna hatte Hunger. Sie war an regelmäßige Mahlzeiten gewöhnt und jetzt hatte sie seit zwei Tagen nicht mehr richtig warm gegessen. Sie ärgerte sich, weil sie eigentlich gar nicht vorgehabt hatte, hier etwas zu essen. Sie wollte nur weg. Aber ihr Magen krampfte vor Hunger.
Der Bohnenkorb war noch immer halb voll.
Auf dem Hof klapperten schnelle Schritte. Eine junge Frau kam herein, ging auf Johanna zu, gab ihr die Hand und begrüßte sie. »Ich bin die Tochter. Maria heiße ich. Du wirst bei mir in der Kammer schlafen. Nach dem Essen zeig ich dir, wo du deine Sachen hintun kannst.«
Kurz darauf kamen drei Buben, der älteste etwa in Johannas Alter. Sie warfen ihre Schultaschen in eine Ecke, setzten sich zum Tisch und klapperten mit den Löffeln gegen die Tischplatte.
Die Bäuerin scheuchte sie hinaus.
»Franz, wasch dir die Hände, die sind kohlschwarz. Josef, hol den Vater, er ist beim Birkenwald unten. Gustl, bring einen Korb Holz.«
Keiner von den dreien beachtete Johanna, die verbissen Bohnen auslöste. Sie war noch lange nicht fertig, als sie sich zum Essen setzten.
»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen.« Mit dem Amen stieß der Bauer seine Gabel in einen Knödel. Die Bäuerin legte ein großes Stück Selchfleisch auf den Teller des Bauern und kleinere Stücke auf die Teller der Buben. Dann nahm sie sich selbst. Ferdl und Johanna bekamen nur Kraut und Knödel.
Nach dem Essen fuhren Johanna und Maria mit dem Bauern auf die Wiese, das letzte Heu wenden. Maria sah Johanna einige Male von der Seite an, als wollte sie etwas sagen, ließ es aber bleiben.
Der Rechen war schwerer als der Rechen daheim. Johanna spürte, wie die Müdigkeit in ihren Armen wuchs und dass diese Müdigkeit sogar an ihrer Wut zehrte.
Es dämmerte, als sie die letzte Reihe wendeten. Auf dem Heimweg wurde es völlig dunkel. Der Wald raschelte und knisterte. Ein Vogel flog auf, irgendwo im Graben heulte ein Hund, oder vielleicht war es ein Fuchs.
Suppe und Brot standen schon auf dem Tisch. Josef schlief, den Kopf auf die Arme gebettet. Johanna hatte Mühe, den Löffel zum Mund zu führen. Gearbeitet hatte sie immer, aber es hatte zwischendurch Pausen gegeben, die andere Maria, ihre Ziehschwester, hatte mit ihr geredet, sie hatten sich in den Schatten gesetzt. Es war einfach anders gewesen, ganz anders. Dort war sie daheim gewesen. Hier war sie die Dirn.
Maria führte sie in einen kellerartigen Verschlag hinter der Küche, in dem zwei Betten und ein Schrank standen. Der Schrank gehörte Maria. »Du kannst deine Sachen in den Kasten oben auf dem Speicher tun. Ich zeig dir morgen, wo.«
Johanna verhedderte sich beim Ausziehen, war plötzlich in den Ärmeln ihres Kleides gefangen. Fast hätte sie um Hilfe gerufen. Der Strohsack roch modrig. Das grobe Bettzeug kratzte.
Die anderen
Johanna lernte sehr schnell sich zurechtzufinden. Sie merkte sich, wo die Geräte aufbewahrt wurden – nicht so sehr aus Diensteifer, sondern weil sie es vermeiden wollte, jemanden direkt anzureden. In jeder Antwort, besonders in jeder Antwort der Bäuerin, schwang ein Vorwurf mit. Vor allem aber wollte Johanna noch immer nicht glauben, dass sie wirklich bleiben musste. Jeden Abend sagte sie sich: Morgen gehe ich. Morgen sage ich ihnen, dass ich nicht bleibe. So war es nicht ausgemacht. Das war eine Art Nachtgebet.
Sie redete eigentlich nur mit den Kühen, wenn sie sie vor dem Melken striegelte. Die Kühe hielten still, wenn man mit ihnen sprach. Sie lernte ihre Eigenheiten kennen. Es wunderte sie, dass es auch hier eine Bless gab, obwohl doch sonst alles so anders war als unten im Burgenland, und dass auch hier die Bless die Kuh war, bei der man am meisten aufpassen musste, wenn man nicht einen Kuhschwanz ins Gesicht bekommen wollte.
Das Dorf war noch kleiner als das, aus dem sie gekommen war. Es gab nicht einmal einen Laden, nur sieben geduckte Häuser, die mit einem Fenster zur Straße schielten und mit den anderen Fenstern ihre Innenhöfe bewachten, und es gab eine Kapelle aus Backstein mit vier Bänken auf der Frauenseite und vier Bänken auf der Männerseite. In dieser Kapelle wurde zweimal im Jahr Messe gelesen, zum Erntedank und zum Fest des Kirchenpatrons. Im Turm hing eine kleine Glocke, die reihum von den Dorfbewohnern geläutet wurde, in der Früh um sechs, zu Mittag und um sechs Uhr abends. Auf der Eisenkette vor der Kirchentür schaukelten die kleinen Kinder oder sie hockten unter der Kastanie neben der Kapelle, wenn sie miteinander tuschelten oder spielten. Es gab ein Wirtshaus am Ortseingang und an jedem Ende des Dorfes eine Villa. Die eine gehörte einem Oberstaatsanwalt aus Graz, die andere einem Postkartenfabrikanten aus Wien.
Wenn ein Bauer oder eine Bäuerin in die Küche trat, sagte die Bäuerin: »Das ist unsere neue Dirn.« Als ob Johanna keinen Namen hätte.
Ihr war es recht. Sie brauchte keinen Namen für diese Leute.
Am ersten Sonntag stellte sie fest, dass sie die Schuhe von Fräulein Olga nicht mehr anziehen konnte. Sie hatte eine Beule am linken Fuß, die zu eitern begann, und die Schuhe waren ohnehin längst zu klein gewesen. Johanna kam frisch gewaschen, aber barfuß zum Frühstück.
»So kannst du nicht in die Kirche gehen«, sagte die Bäuerin. »Man muss sich ja schämen mit dir. Schäl die Erdäpfel, wasch den Salat und begieß den Braten!«
Johanna war zum ersten Mal allein im Haus. Mehr noch als in Gegenwart der Bäuerin hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Als der Wind die Kammertür zuschlug, zitterte Johanna vor Angst. Es dauerte Minuten, bis sie weiterschälen konnte. Sie war erleichtert, als die Hausleute vom Kirchgang zurückkamen und das Knarren und Ächzen der alten Dielen übertönten.
Nach dem Mittagessen sagte die Bäuerin: »Wenn du das Geschirr fertig hast, kannst du bis um sechs freihaben. Aber um sechs bist du pünktlich zurück.«
Es war einer von jenen Oktobernachmittagen, die voll sind von silbrig glänzendem Altweibersommer. Sogar der Misthaufen leuchtete dunkelgolden und die kreuz und quer hingeworfenen trockenen Äste neben dem Küchengarten auch.
Eine einzige Wolke hing über dem Bergrücken, schief und wie vergessen. Johanna ging langsam die Dorfstraße entlang, die sich in einen Feldweg verlief. Der Sand zwischen ihren Zehen war warm. Sie bewegte die Zehen auf und ab.
An der Biegung, wo zwei riesige Birken den kleinen »oberen Birkenwald« überragten, rief jemand: »He, du!« Sie blieb stehen.
»Hier sind wir!«
Die Stimme kam von oben.
Johanna sah sich um. Es kicherte schräg über ihr, sie sah noch immer niemanden.
»Komm herauf!«
Der Hochstand, natürlich! Aus dem Hochstand kamen die Stimmen und das Gelächter. Nun winkten auch mehrere Hände. Sie ging zum Hochstand, kletterte über die Leiter hinauf.
Auf den beiden schmalen Bänken saßen fünf Mädchen.
»Ich bin die Romana«, sagte eine mit blonden Zöpfen und schwarzen Augenbrauen, die sich über der Nasenwurzel trafen.
»Das ist die Gundl, die Hemma, die Rosa und die Annerl.«
Johanna stand drei Stufen unter den Mädchen.
»Ich heiße Johanna«, sagte sie. »Ich bin beim Lahnhofer. Aber ich bleib nicht«, fügte sie hinzu.
Romana lachte. »Kannst dich trotzdem niedersetzen.« Sie rückte näher zu Gundl und deutete auf die Bank.
Johanna setzte sich. Gundl hatte eine hässliche Narbe quer über der linken Wange.
»Und wohin willst du gehen?«, fragte Romana.
»Heim. So war das nicht ausgemacht. Ich bin hergekommen, damit ich Schneiderin werde. Ich fahr zurück.«
Romana lachte. Die anderen kicherten.
»Glaubst du vielleicht, die lassen dich?«, fragte Romana. »Die lassen dich nicht! Du bist doch auch ledig?«
»Ja«, sagte Johanna.
Romana schüttelte den Kopf. »Du bist aber ganz schön blöd. Glaubst du, der Lahnhofer lässt dich? Da wäre er ja saudumm. Er bekommt zwanzig Schilling Kostgeld für dich von der Gemeinde. Und wenn er eine Dirn nimmt, muss er ihr zwanzig Schilling zahlen. Wie viel ist zwanzig und zwanzig?«
Johanna schwieg.
»Die weiß nicht, wie viel zwanzig und zwanzig ist«, sagte Hemma, die den Kopf schief hielt. »Aber heimfahren will sie!«
»Schuhe hat sie auch keine«, sagte Gundl.
Annerl blinzelte Johanna zu.
Romana knotete ihre Zöpfe wie die Bänder einer Haube unterm Kinn zusammen. »Weg kannst du nicht. Der Lahnhofer ist doch sogar Armenrat, der lässt dich zurückholen, wenn du gehst. Der kann das. Weißt du, mit wem seine Schwester verheiratet ist? Mit dem Postenkommandanten.«
»Aber es war nicht so ausgemacht«, beharrte Johanna. »Ich bin ja nur weggefahren vom Burgenland, damit ich was lernen kann.«
»Ausgemacht!«, sagte Romana. »Das war doch nur mit dir ausgemacht. Meinst du, das zählt?«
»Mit der Mama auch, sonst hätte sie mich gar nicht gehen lassen.« Johanna ärgerte sich, dass sie dieser hochnäsigen Romana überhaupt eine Antwort gab.
»Du warst bei deiner Mutter?«, fragte Romana überrascht.
»Ziehmutter.«
»Siehst du.« Romana schien befriedigt. »Sag ich doch! Die Ziehmutter ist sicher froh, dass sie dich los ist.«
»Nein!«
Gundl zog an ihren Fingern, bis die Knöchel knackten. »Die hat noch Rosinen im Kopf!«, stellte sie fest. »Die glaubt sicher auch an den Storch.«
»Und an den Osterhasen«, fügte Hemma hinzu.
Ich gehe trotzdem, dachte Johanna. Ihr könnt von mir aus reden, solange ihr wollt.
Aber sie merkte, dass sie sich selbst nicht mehr überzeugen konnte. Sie wäre gern weggelaufen.
»Von wo kommst du?«, fragte Annerl.
»Aus dem Burgenland. Bei Güssing. Und die Mutter hat mir das Fahrgeld in die Schürze genäht!«
»Das nehmen sie dir noch weg, wenn du so redest.« Plötzlich legte Romana den Arm um Johannas Schulter. »Du hast eh Glück. Die Lahnhofer sind nicht die Ärgsten.« Sie berührte Gundls Wange. »Der Murer schlägt mit der Peitsche.«
Johanna war froh, als sie von anderen Dingen zu sprechen begannen, von einer bevorstehenden Hochzeit, von der Krankheit der alten Schwinghammer, von dem Kind, das die Murertochter angeblich erwartete.
»Er heiratet sie sowieso«, sagte Gundl.
»Er heiratet sie nicht! Der heiratet eine aus Trattenbach, das hat mir die Faßbinderin selbst erzählt«, trumpfte Rosa auf. Gundl erzählte wichtig, die Bäuerin sei gestern mit der Tochter zur Schneiderin gefahren. Und neue Schuhe habe sie auch gekauft. »Wozu braucht sie neue Schuhe, wenn sie nicht heiratet?« Ich weiß, was ich tu, dachte Johanna. Ich schreibe an meinen Vater. Die Adresse steht in den Papieren. Ich schreibe ihm und frage ihn, warum er meine Mutter nicht geheiratet hat. Es war ihr gleichgültig, dass sie nicht wusste, warum die anderen lachten und sich gegenseitig anstießen. Die sollten sie ruhig für blöd halten.
Totenwache
Der erste Monat war vorbei.
Im Stall, im Küchengarten, abends im Bett und beim Kühehüten auf den abgeernteten Feldern überlegte Johanna, was sie ihrem Vater schreiben sollte. Schon die Anrede machte ihr Schwierigkeiten.
»Lieber Vater«?
Lieber?
Und Vater?
Vater ist Vater.
Du sollst Vater und Mutter ehren.
»Geehrter Herr Vater!«
Und wenn sie schrieb, würde das einen Unterschied machen? Jetzt plötzlich? Nach dreizehn Jahren und elf Monaten?
Schließlich schrieb sie doch, steckte den Brief in eines der Kuverts, die ihr die Ziehmutter mitgegeben hatte und auf denen schon die Briefmarken klebten. Sie warf es in den Briefkasten, bevor sie Zeit hatte, es sich noch einmal zu überlegen.
Dann wartete sie auf Antwort.
Wenn sie am Morgen die Kühe austrieb, lag schon Reif auf den Wiesen. Die Kälte biss durch die Hornhaut an ihren Füßen.
Wenn sie es gar nicht mehr aushielt, stapfte sie in einen warmen, dampfenden Kuhfladen und spreizte die Zehen, bis sie wieder beweglich wurden.
An den Sonntagnachmittagen saß sie mit den anderen Mädchen in einem der Hochstände. Romana hatte das Fenster mit Rindenstücken vernagelt und hängte jedes Mal einen Kotzen vor die Türöffnung. Wenn sie zu sechst in dem winzigen Raum saßen, wurde es fast warm und gemütlich. Romana führte das große Wort. Sie diente bei der alten Frau Berger, der Mutter des Staatsanwaltes. Ihr ging es gut. Sie hatte nur das Haus und den Küchengarten zu versorgen, keinen Stall und keine Feldarbeit. Sie musste erst um sechs Uhr aufstehen und am Sonntag um sieben. In den Ferien, wenn der Staatsanwalt mit seiner Frau und den drei Kindern kam, hatte sie etwas mehr zu tun, aber auch das war nichts im Vergleich zur Arbeit auf einem Bauernhof, und die Frau Staatsanwalt brachte ihr immer Kleider und Schuhe mit. Romana durfte Radio hören und Zeitung lesen. Wenn die Familie da war, sagte sie, und Besuch kam, gaben ihr die Herren und Damen sogar Trinkgeld.
Alle bewunderten Romana, aber keine so sehr wie Gundl. Gundl versuchte, Romana in allem nachzuahmen, auch wenn sie dafür nur ausgelacht wurde. Gundl war nicht ganz richtig im Kopf, sie musste loslachen oder losweinen, auch wenn sie gar nicht wollte. Manchmal wurde ein Lach- oder Weinkrampf so heftig, dass die Bodenbretter des Hochstands zitterten.
Nach Romana kam Hemma. Rosa und Annerl hatten keine festen Plätze in der Rangordnung, einmal war die eine, einmal die andere die Vorletzte – aber immer noch weit vor Gundl.
Johanna blieb draußen. Sie wollte es selbst so. Sie saß auch immer an dem Platz neben der Türöffnung und der Leiter. Den anderen war das nur recht. Da zog es am meisten.
Romana versuchte Johanna aus ihrer Reserve zu locken. Wenn Johanna die Kühe hütete, richtete es Romana so ein, dass sie auf dem Rückweg vom Laden im nächsten Dorf an der Weide vorbeikam. Johanna freute sich darüber, aber sie blieb auf der Hut, hörte nur zu und redete wenig, vor allem nicht über sich selbst.
Romana wusste Geschichten über jeden im Dorf und in diesen Geschichten kam niemand gut weg.
»Die alte Murer stirbt bald«, berichtete sie. »Sie isst fast nichts mehr. Sie sagt, die Schwiegertochter tut ihr Gift ins Essen. Die Gundl muss immer ein paar Löffel nehmen, bevor sie überhaupt kostet. Die Gundl sagt, man riecht schon den Tod in der Kammer. Der Herr Pusio war auch schon da, vorige Woche.«
»Der Herr Pusio?«
»Der Steinmetz! Sie hat sich ihren Grabstein ausgesucht und die Inschrift, weil sie gesagt hat, die Schwiegertochter nimmt höchstens Sandstein, aber das will sie nicht, sie will Marmor, und sie hat ohnehin gespart darauf ihr Leben lang. Und ihr Sohn, sagt sie, der hat sowieso nichts zu plaudern daheim, der würde seine Mutter auch unter einem Kilometerstein liegen lassen, sagt sie. Die Gundl hat ihr das Brautkleid bügeln müssen, das hängt jetzt in ihrer Kammer, und der Tischler war auch schon da, Maß nehmen.« Romanas Augen funkelten.
Als Johanna die Kühe heimtrieb, versuchte sie unauffällig in das Fenster der alten Frau Murer zu sehen. Die Vorhänge waren zugezogen. Sie bildete sich ein, die scharfe Stimme der alten Frau zu hören, die vor drei Wochen noch jeden Nachmittag auf der Bank vor dem Haus gesessen war und mit allen Vorübergehenden geredet hatte. Die Bäuerin unterhielt sich mit Frau Faßbinder.
»Die tut sich hart mit dem Sterben«, sagte die Bäuerin.
Frau Faßbinder nickte. »Es ist wie mit dem Kinderkriegen. Die eine plagt sich mehr, die andere weniger. Manche lernen es nie, auch wenn sie zwölfe haben. Aber Frauen können besser sterben, im Allgemeinen. Das ist ja das Furchtbare, wenn ich an meinen armen Mann denk und wie er hat in Russland sterben müssen.« Johanna trug die schmutzige Wäsche über den Hof. Die Geschichte des Infanteristen Ambros Faßbinder hatte sie in fünf Wochen schon mindestens dreimal gehört. Der Dorfklatsch behauptete, er sei erst nach seinem Tod im Schützengraben zum guten und tüchtigen Mann und treu sorgenden Vater geworden. Vorher hätte ihn seine Frau beschimpft, wenn er abends aus dem Wirtshaus kam, und sie hätten sich geprügelt.
Das Dorf wartete. Wenn zwei zusammenstanden, redeten sie davon.
Gundl fürchtete sich davor, der alten Frau das Essen zu bringen.
»Was ist, wenn ich reinkomme und sie ist schon tot?«
»Dann gehst du wieder«, sagte Romana. »Weil sie dann das Essen nicht mehr braucht.«
Am Mittwochvormittag war Gundl plötzlich verschwunden. Die junge Murer suchte sie im ganzen Dorf. Die Wäsche war seit zwei Tagen eingeweicht und Gundl sollte waschen.
Niemand hatte sie gesehen, seit sie am frühen Morgen mit dem Kaffee zur alten Murer gegangen war.
Als Johanna Holz aus dem Schuppen holte, stand Frau Faßbinder mit der jungen Murer auf der Straße.
»Ich will ja nichts gesagt haben, aber es ist mir schon aufgefallen, wie eure Gundl dreingeschaut hat. Seit zwei, drei Wochen schon, und da haben sich doch Zigeuner hier herumgetrieben. Wundern würde es mich nicht, aber wie gesagt, ich will nichts gesagt haben. Aber ich würde die Gendarmerie verständigen.« Frau Faßbinder faltete die Hände über dem Bauch.
»Wir haben immer auf sie geschaut«, verteidigte sich die junge Murer.
Frau Faßbinder senkte die Stimme. Johanna musste sich anstrengen, um sie zu verstehen. »Du weißt ja, solche sind oft besonders hitzig. Die hört was, die sieht was … und schon ist’s passiert.«
»Bei uns nicht!« Die junge Murer war wütend.