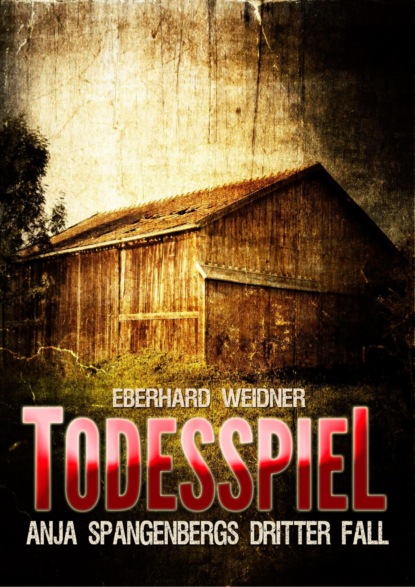Полная версия:
Eberhard Weidner DAS BUCH ANDRAS I
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Ich glaubte, einen schwachen Sog wahrzunehmen, der von dieser unheimlichen Leere in meinem Gedächtnis ausging, nach meinem tastenden Verstand griff und ihn in das unheimliche Nichts zerren wollte wie in ein schwarzes Loch. Ich zog meine Gedankenfinger daher so schnell wie möglich wieder etwas zurück, konnte es jedoch nicht lassen, weiterhin die Ränder dieses Leerraums prüfend abzutasten, so wie man mit der Zunge immer wieder ungewollt über eine wunde Stelle im Zahnfleisch streicht, obwohl man genau weiß, dass man das besser bleiben lassen sollte. Ich stellte dabei fest, dass es im Grunde keinen gleitenden Übergang gab, sondern der Bereich mit intakten Erinnerungen – die allerdings nur allgemeine und keine persönlichen Dinge betrafen – schlagartig endete, so als wäre mit einem scharfen Skalpell ein bestimmter Bereich meines Gehirns herausgeschnitten worden. Das war natürlich absoluter Blödsinn, wie selbst mir als Laie im Bereich der Gehirnchirurgie klar war.
Ich testete Erinnerungen und Fähigkeiten, die in den unbeschädigten Bereichen meines Verstandes gespeichert waren. Ich konnte mich an zahlreiche Personen der Zeitgeschichte, Orte, geschichtliche Ereignisse und eine Unmenge anderer Dinge erinnern. Ich war problemlos in der Lage, einfache und sogar kompliziertere Rechenaufgaben zu lösen und ganze, willkürlich gewählte Sätze ins Englische, ins Französische und teilweise sogar ins Lateinische zu übersetzen, obwohl ich bei Letzterem schon größere Schwierigkeiten hatte.
Insgesamt betrachtet machte es mir also keine besondere Mühe, mich innerhalb kurzer Zeit an all diese eher allgemeinen Informationen zu erinnern. Doch sobald ich wieder in den Bereich vorstieß, in dem sich die persönlichen Erinnerungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens in seinem Gedächtnis abspeichert, hätten befinden müssen, fand ich nichts anderes als die schrecklich gähnende Leere. Alles, was mich persönlich betraf – mein Name, meine gesamte Vergangenheit, im Grunde mein komplettes bisheriges Leben –, war wie ausgelöscht. Beinahe kam es mir so vor, als hätte ich vor meinem Erwachen überhaupt nicht existiert.
Ein furchtbarer Gedanke, der mir Angst machte.
Kapitel 3
Schließlich gab ich auf, zog meine gedanklichen Finger aus den Tiefen meines Verstandes und öffnete die Augen.
Es waren scheinbar nur wenige Sekunden vergangen, obwohl es mir wie eine Ewigkeit vorgekommen war, denn Gabriels Gesichtsausdruck hatte sich nicht im Geringsten verändert. Immer noch sah er interessiert und freundlich auf mich herab und wartete auf eine Antwort, ohne zu ahnen, welches Drama sich soeben in meinem Verstand abgespielt hatte.
Ich spürte den Schweiß, der mir unter anderem in Form unzähliger kleiner Perlen auf der Stirn stand, und hatte plötzlich Mühe, ein Schluchzen und die Tränen zurückzuhalten, die meine Augen zu überschwemmen drohten. Zu groß war in diesem Moment die Enttäuschung über die niederschmetternde Erkenntnis, dass ich eine Frau ohne Namen und Vergangenheit war.
Da ich befürchtete, in lautes, unkontrollierbares Schluchzen auszubrechen, sollte ich versuchen, auch nur ein einziges Wort zu äußern, beschränkte ich mich darauf, den Kopf zu schütteln. Dabei lösten sich zahlreiche Schweißtropfen von meiner Stirn, liefen mir übers Gesicht und vermischten sich mit ein paar Tränen, die ich nicht zurückhalten konnte und die mir aus den Augenwinkeln rannen.
Gabriel verstand, was ich damit ausdrücken wollte. Er nickte, während sich ein mitfühlender Ausdruck auf seinem Gesicht ausbreitete. In diesem Moment glaubte ich zu erkennen, dass in der breiten Brust dieses im wahrsten Sinne des Wortes großen Mannes auch ein mindestens ebenso großes Herz schlagen musste.
»Das haben wir befürchtet!« Gabriel runzelte nachdenklich die Stirn, ließ aber offen, wen er mit wir meinte. »Aber wenigstens kann ich Ihnen in einer Sache weiterhelfen: Ihr Name ist Sandra Dorn.«
Sandra Dorn – Sandra Dorn – Sandra … Dorn – Sandra … Dorn – San…dra … Dorn – Sa…n…d…ra … D…or…n …
Der Name wirbelte durch meinen Kopf wie eine aufgeregte Fliege in einem verschlossenen Marmeladenglas, erzeugte immer wieder neue Echos, die von den Innenwänden meines Schädels abprallten wie verbale Querschläger, sich überlagerten und in ihre Einzelteile, ihre Silben, ja sogar ihre einzelnen Buchstaben zersplitterten, bis die beiden Worte jegliche Bedeutung verloren hatten, ohne während all dessen auch nur einmal ein Gefühl von Vertrautheit oder Wiedererkennen in mir auszulösen.
Zunächst hatte ich noch gehofft, die Nennung meines Namens würde, einer Initialzündung gleich, eine Flut weiterer Erinnerungen auslösen, die aus den Tiefen meines Unterbewusstseins hervorströmten und meinen Verstand überschwemmten, doch nichts dergleichen geschah. Es schienen nur zwei einfache Worte zu sein, die Bezeichnung einer Person zwar, aber ohne eine besondere Beziehung zu mir oder eine tiefere Bedeutung für mich persönlich.
Dennoch war dieser Name im Augenblick scheinbar alles, was mir von meinem bisherigen Leben geblieben war, sodass ich ihn trotz seiner anfänglichen Fremdheit dankbar annahm wie ein kostbares Geburtstagsgeschenk und sogleich in verschiedenen Variationen in Gedanken benutzte, um mich daran zu gewöhnen: Sandra Dorn. Mein Name ist Dorn, Sandra Dorn. Ich heiße Sandra Dorn. Hallo, ich bin Sandra. Vielleicht, so hoffte ich, würde er mir mit der Zeit und mit dem Grad seiner Anwendung vertrauter werden, so wie man neue Schuhe auch erst einlaufen muss, bevor sie hundertprozentig passen.
»Frau Dorn?«
Gabriel hatte mich wohl schon mehrmals mit meinem Namen angesprochen, bevor ich endlich darauf reagierte. Einerseits war ich tief in Gedanken versunken gewesen, zum anderen hatte ich noch Startschwierigkeiten, mich an den für mich in meiner gegenwärtigen Situation noch unvertraut klingenden Namen zu gewöhnen und dementsprechend zu reagieren, wenn ich ihn hörte.
»Hat Ihr Name weitere Erinnerungen in Ihnen ausgelöst?«, fragte Gabriel, als ich ihm wieder meine volle Aufmerksamkeit schenkte.
»Nein!« Es gelang mir, dieses eine Wort zu sagen, ohne in Tränen auszubrechen. Die Traurigkeit darüber, all meine wertvollsten Erinnerungen an mein früheres Leben und mein Ich verloren zu haben, war noch nicht vollständig abgeklungen, sondern für den Augenblick allenfalls an den Rand meines Bewusstseins verlagert worden. Ich hegte jedoch die Befürchtung, dass sie dort geduldig darauf wartete, um zu gegebener Zeit und aus gegebenem Anlass erneut über mich herzufallen. Es sei denn, es gelang mir vorher, meine Erinnerungen auf andere Art und Weise wiederherzustellen, so wie man nach dem versehentlichen Löschen der Festplatte eines Computers auf eine zuvor erstellte Sicherheitskopie zurückgreift. Ich besaß zwar kein solches Backup meiner Erinnerungen, möglicherweise konnte ich die Lücken aber durch Informationen füllen, die ich von anderen erhielt. Schon formte sich in meinem Kopf ein wahrer Katalog weiterer Fragen, die meine Aufmerksamkeit so vollständig gefangen nahmen, dass mir schon aus diesem Grund keine Zeit blieb, weiterhin Trübsal zu blasen.
Gabriel musste mir angesehen haben, dass ich mich wieder gefangen hatte und ihn jeden Moment mit einem weiteren Bombardement an Fragen eindecken würde. Bevor ich auch nur eine einzige davon stellen konnte, nahm er mir aber schon den Wind aus den Segeln, indem er sagte: »Ich bin im Augenblick leider nicht in der Lage, Ihnen weitere Fragen zu beantworten, Frau Dorn. Vielleicht kann Ihnen aber Dr. Jantzen dabei helfen, die eine oder andere Lücke in Ihrem Gedächtnis zu füllen. Sobald er erfahren hatte, dass Sie aufgewacht und allem Anschein nach wieder bei Sinnen sind, wies er mich an, Sie zu ihm zu bringen.«
»Wieder bei Sinnen …?«, wiederholte ich nachdenklich. Zumindest wurde mir nun ansatzweise bewusst, warum ich mit Ledergurten ans Bett gebunden worden war. Ich war wohl nicht bei Sinnen gewesen, was immer das im konkreten Fall bedeutete.
Erneut schien mir Gabriel anzusehen, was ich dachte. Vielleicht war ich auch nur sehr einfach zu durchschauen. Was wusste ich denn schon über mich? Gar nichts!
»Sie haben richtiggehend getobt«, konkretisierte der Pfleger seine vorherige Aussage. »Nachdem Sie eingeliefert worden waren, haben Sie jedes Mal, sobald Sie erwacht sind, fürchterlich geschrien, um sich geschlagen, getreten und sogar gebissen. Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit des Personals mussten wir Sie fixieren …« Bei diesen Worten wies er mit der rechten Hand nacheinander auf die diversen Ledergurte. »… und medikamentös ruhigstellen. Der Durst und die Kopfschmerzen kommen wahrscheinlich davon.«
Möglicherweise hatte er mir damit weitaus mehr erzählt, als er eigentlich vorgehabt hatte, und unweigerlich einen Rattenschwanz weiterer Fragen aufgeworfen. Doch bevor ich auch nur ein Wort äußern konnte, vollführte er mit der Hand wieder eine entschlossene Geste, die mir Schweigen gebot.
»Da Sie jetzt wach und nach meinem ersten Eindruck auch wieder endgültig bei Sinnen sind, gehe ich davon aus, dass die Fixierung durch die Gurte nicht länger erforderlich ist. Wenn Sie mir versprechen, keine Schwierigkeiten zu machen, kann ich auch davon absehen, Ihnen zur Sicherheit eine Zwangsjacke anzuziehen.«
Mir wurde bereits bei der bloßen Vorstellung ganz anders, in einer Zwangsjacke durch das Gebäude zu diesem Doktor Jantzen geführt zu werden. »Was immer vorher mit mir los war, jetzt bin ich wieder vollkommen klar im Kopf«, versicherte ich dem Pfleger daher rasch und ergänzte, wenn auch nur in Gedanken: Abgesehen von einer Gedächtnislücke so groß wie ein Fußballfeld. Laut fuhr ich fort: »Ich verspreche hoch und heilig, Ihnen keine Schwierigkeiten zu bereiten. Großes Indianerehrenwort. Ich werde ganz brav sein.« Meine Worte klangen zwar ziemlich kindisch, doch ich meinte sie ernst. Und wenn ich meine Hände hätte bewegen können, dann hätte ich meine Worte sogar durch die entsprechenden Gesten ergänzt, so eifrig war ich bemüht, Gabriel von meiner Ernsthaftigkeit zu überzeugen, denn eine Zwangsjacke war in meiner Vorstellung zu eng mit dem Begriff »Irrsinn« verknüpft. Möglicherweise befürchtete ich, neben dem offensichtlichen Problem mit meiner Erinnerung tatsächlich den Verstand zu verlieren, sobald man mich in eine Zwangsjacke stecken würde.
Meine ernsthaften Worte und vermutlich auch mein Gesichtsausdruck mussten überzeugend genug gewesen sein, denn Gabriel nickte schließlich. »Gut, dann will ich Ihnen mal glauben. Sobald ich die Gurte entfernt habe, können Sie diese Kleidungsstücke anziehen. Ich hoffe, sie passen halbwegs. Ich werde draußen im Flur warten, bis Sie sich angezogen haben. Danach bringe ich Sie zu Dr. Jantzen. Er wartet bestimmt schon ungeduldig auf uns.« Nach diesen Worten legte er das Kleiderbündel, das er die ganze Zeit über dem linken Unterarm getragen hatte, direkt neben meinem Kopf auf dem Bett ab und begann dann, nacheinander die Gurte zu lösen.
Kapitel 4
Dr. Jantzen machte überhaupt nicht den Eindruck, als hätte er ungeduldig auf mein Erscheinen gewartet. Ganz im Gegenteil: Er hatte mich weder begrüßt, als Gabriel mich in den Raum geführt hatte, noch hatte er bislang in sonst einer äußerlich erkennbaren Weise meine Gegenwart zur Kenntnis genommen. Er blätterte stattdessen in einem schmalen Hefter, dessen Inhalt seine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Man musste kein Albert Einstein sein, um zu erraten, dass es sich bei der Mappe wohl um meine Krankenakte handelte. Sie war zum Glück nicht sehr umfangreich. Dies weckte in mir die berechtigte Hoffnung, dass ich kein Dauergast in dieser oder einer ähnlichen Einrichtung war, sondern nur aufgrund eines unglücklichen Umstands, möglicherweise eines Irrtums – wogegen aber mein von Gabriel erwähntes Toben in den letzten Tagen sprach –, für kurze Zeit hier gelandet war und bald wieder in mein Leben, wie immer dieses auch aussehen mochte, zurückkehren konnte.
Der Arzt und ich saßen uns in einer Art Besprechungszimmer gegenüber, jeder an der Schmalseite eines langen Tisches, der, wäre er auch nur um wenige Meter länger, es wohl erforderlich gemacht hätte, dass wir uns schreiend verständigen oder mit Walkie-Talkies ausgerüstet werden mussten. Allerdings war es weder von seiner noch von meiner Seite bislang zu einem Versuch der Verständigung gekommen. Vielleicht hatte der gute Doktor auch Angst, Schwachsinn könnte ansteckend sein, und versuchte daher, so viel Raum wie nur möglich zwischen sich und seine Patienten zu bringen.
Ich trug mittlerweile nicht mehr den blauen Schlafanzug, in dem ich erwacht war, sondern schlichte weiße Baumwollunterwäsche, eine hellblaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt ohne Aufdruck, weiße Socken und ein Paar einfacher, weißer Leinenturnschuhe. Nicht alles davon passte wirklich hundertprozentig, weswegen ich davon ausging, dass es nicht meine eigenen Sachen waren. Was mit meiner Kleidung geschehen war und warum ich fremde Sachen anziehen musste, waren zwei weitere Rätsel, die sich in die lange Liste der Fragen einreihten, auf die ich mir von Dr. Jantzen im Laufe unseres bevorstehenden Gesprächs Antworten erhoffte.
Auch wenn mein erster Eindruck von Dr. Jantzen aufgrund seines distanzierten Verhaltens nicht der allerbeste war, war mir dennoch bewusst, dass mein weiterer Aufenthalt in dieser Einrichtung und die Umstände desselben wohl in erster Linie vom Urteil dieses Mannes abhängen würden. Ich hatte daher nicht vor, ihn schon bei unserer ersten Begegnung allein dadurch gegen mich aufzubringen, indem ich ihn beim Studium meiner Krankenakte störte. Aus diesem Grund übte ich mich vorerst in Geduld und trank gelegentlich von dem Wasser, das Gabriel mir unmittelbar nach unserer Ankunft in einem großen Glas zusammen mit einer Aspirin-Tablette gegen meine Kopfschmerzen gebracht hatte. Ich vermeinte bereits zu spüren, dass der pochende Schmerz in meinem Schädel von Minute zu Minute schwächer wurde, während Dr. Jantzen sich Seite um Seite durch die zum Glück nicht sehr umfangreiche Akte arbeitete und scheinbar jeden einzelnen Abschnitt sehr aufmerksam und teilweise sogar mit gerunzelter Stirn studierte. Immerhin verhalf mir diese Geduldsprobe zu einem weiteren kleinen Mosaiksteinchen in meinem verlorenen Selbstbildnis, indem sie mir zeigte, dass ich, wenn es darauf ankam, geduldig sein konnte.
Anfangs verkürzte ich mir die Wartezeit dadurch, dass ich aus dem Fenster sah, das sich schräg hinter Dr. Jantzen befand. Es war schließlich das erste Fenster, durch das ich seit meinem Erwachen nach draußen sehen konnte, denn weder der winzige Raum, in dem ich zu mir gekommen war, noch die Flure, durch die wir hierhergekommen waren, hatten Fenster gehabt. Allerdings wurde mir schnell langweilig, denn alles, was ich sehen konnte, waren das sattgrüne Laub zahlreicher Bäume und darüber ein Streifen des strahlend blauen Himmels. Wenn mich meine Erinnerung in dieser Hinsicht nicht ebenfalls im Stich ließ, dann musste es Mitte bis Ende Juni sein, an das genaue Datum konnte ich mich aber beim besten Willen nicht erinnern.
Gabriel stand währenddessen wie ein Wachtposten schräg hinter mir und lehnte mit dem Rücken an der Wand. Als ich mich kurz nach ihm umsah, schien er in Gedanken versunken zu sein. Wahrscheinlich war er die Eigenheiten von Dr. Jantzen gewöhnt und hatte, weil es im Augenblick für ihn nichts zu tun gab, geistig abgeschaltet. Vielleicht spielte er auch gerade im Kopf eine komplizierte Schachpartie gegen sich selbst oder dichtete Haikus. Beides hätte ich ihm durchaus zugetraut.
Um nicht ebenfalls mangels äußerer Anreize geistig auf Sparflamme zu schalten, spulte ich mein Leben im Kopf kurzerhand um ein paar Minuten zurück und ließ gedanklich erneut einen Teil der Eindrücke Revue passieren, die ich gewonnen hatte, als ich an Gabriels Seite durch die Flure dieses Gebäudeteils hierhermarschiert war.
Eigentlich hatte ich mir das Innere einer Irrenanstalt – denn um eine solche handelte es sich aller Voraussicht nach, so viel war mir inzwischen klar geworden – ein wenig anders vorgestellt. Falls ich bereits vor meinem jetzigen Aufenthalt Erfahrungen mit dem Innenleben einer Klapsmühle gemacht hatte, so waren diese zusammen mit den anderen persönlichen Erinnerungen über Bord gegangen und gehörten damit zu den wenigen, die von mir nicht sonderlich vermisst wurden. Mein diesbezügliches Wissen beschränkte sich daher, wie bei den meisten Menschen, eher auf allgemeine Eindrücke, Bilder und Sätze, die aus Filmen, Fernsehberichten, Illustrierten oder Büchern stammen mussten.
Nachdem ich mich umgezogen hatte, ließ mich Gabriel aus dem Zimmer, in dem ich zu mir gekommen war. Ich hatte insgeheim damit gerechnet, mich in einem düsteren Gang wiederzufinden, in dem sich auf beiden Seiten eine verriegelte Zellentür an die andere reihte. Zellentüren, hinter denen all die Verrückten in winzige Räume eingeschlossen waren wie Gefangene in einem mittelalterlichen Verlies. Die Realität sah natürlich ganz anders aus.
Der Raum, aus dem ich in den hell erleuchteten, in freundlichen Farben gestrichenen Flur trat, wurde Beruhigungsraum genannt und diente dazu, gewalttätige Patienten für eine Weile zu isolieren und ruhig zu stellen, bis sie sich wieder beruhigt hatten. Das erklärte mir Gabriel während unseres kurzen Spaziergangs zu meinem Blind Date mit Dr. Jantzen.
Ansonsten beherbergte diese Abteilung ohnehin nur leichtere Fälle, was mich schon einmal beruhigte, sah ich mich doch selbst keineswegs als Verrückte. Die Türen zu zahlreichen Patientenzimmern, die wie Zimmer in einem Wohnheim eingerichtet waren, und zu den großen Aufenthaltsräumen, in denen die Insassen an mehreren Tischen Brett- oder Kartenspiele spielen, lesen, stricken, sich unterhalten oder abends fernsehen konnten, standen offen, und es herrschte ein reges Kommen und Gehen auf den Fluren. Nur wenige Türen – vor allem Toiletten, Baderäume, Schwesternzimmer, Therapieräume etc. – waren geschlossen.
Auf den Fluren, durch die wir auf unserem Weg kamen, begegneten uns zahlreiche Personen. Andere hielten sich in einem der Aufenthaltsräume oder ihren Zimmern auf und gingen diversen Tätigkeiten nach. Das Personal – Schwestern, Pfleger, Ärzte – konnte man daran erkennen, dass sie in der Regel in Weiß gekleidet waren so wie Gabriel, der vielen grüßend zunickte oder sogar beim Namen nannte.
Die Patienten trugen hingegen überwiegend normale Straßenkleidung, so wie in meinem Fall, einige auch bequeme Jogging- oder Hausanzüge und manche lediglich Morgenmäntel über ihren Schlafanzügen oder Nachthemden, als wären sie gerade erst aufgestanden und auf dem Weg zum Frühstück, obwohl es dafür bereits viel zu spät war.
Letztere machten in der Regel einen zutiefst verwirrten oder sogar komplett weggetretener Eindruck, starrten beispielsweise die weiße Wand oder den Boden zu ihren Füßen an, während sie teilweise unverständliche Laute von sich gaben, oder tanzten zu Melodien, die nur sie hören konnten. Diesem Personenkreis war noch am ehesten anzusehen, dass sie an diesem Ort genau richtig waren und wahrscheinlich nie mehr – schon zu ihrem eigenen Besten – von hier weggehen würden. Bei vielen anderen fiel es mir dagegen schon wesentlich schwerer oder war es sogar schlichtweg unmöglich, sie allein aufgrund ihres äußeren Eindrucks als Irre zu identifizieren. Wäre ich einigen von ihnen in der U-Bahn oder auf der Straße begegnet, hätte ich sie kaum eines zweiten Blickes gewürdigt, so normal wirkten sie auf mich. Trotzdem gab es vermutlich bei allen einen guten Grund, weswegen sie schlussendlich an diesem Ort gelandet waren.
Ich betrachtete all diese Menschen nicht als Leidensgenossen, da ich mich eben nicht wie eine Verrückte, also wie eine von ihnen fühlte. Schließlich litt ich nur unter einer Erinnerungslücke, auch wenn diese Lücke, um ehrlich zu sein, nicht gerade klein, sondern eher so breit wie eine dreispurige Autobahn zu sein schien. Aber nur wegen fehlender Erinnerungen war man doch noch lange nicht verrückt, oder? Na schön, ich sollte seit meiner Einlieferung wie die sprichwörtliche Wahnsinnige getobt und sogar andere gebissen haben, was Menschen, die als normal angesehen werden und alle Tassen im Schrank haben, in der Regel nicht tun. Aber das war vorbei. Seit meinem Erwachen war ich doch wieder vollkommen normal, oder? Zumindest fühlte ich mich, abgesehen von meinen fehlenden Erinnerungen, vergleichsweise normal und hoffte, dass Dr. Jantzen diese geistige Normalität alsbald bestätigen und mir zur Entlassung aus dieser Irrenanstalt zurück in die Freiheit verhelfen würde.
Doch diese Hoffnung war nicht völlig ungetrübt, denn meine fehlenden Erinnerungen hingen nach wie vor bedrohlich wie ein Damoklesschwert über mir. Schließlich wusste ich nicht einmal, wo ich nach meiner Entlassung hingehen sollte. Wo wohnte ich? Welche Personen kannte ich dort draußen? Wo war meine Familie? Wer waren meine Freunde? Ich hatte unzählige Fragen, auf die ich mir durch das Gespräch mit Dr. Jantzen Antworten erhoffte.
Doch bevor ich mir weitere Gedanken über meinen eigenen Geisteszustand im Vergleich zu dem der übrigen Insassen machen konnte, wurde ich abrupt in die Realität zurückgeholt, als Dr. Jantzen seine fesselnde Lektüre beendete und bereit war, sich endlich mit mir zu befassen.
Kapitel 5
»Guten Tag, Frau Dorn«, sprach mich Dr. Jantzen an und riss mich damit aus meinen Überlegungen. Dies erfolgte für mich so unerwartet, dass ich erschrocken zusammenzuckte und ihn erst einmal mit großen Augen anstarrte, als sähe ich ein Gespenst oder ein rosa Kaninchen vor mir und nicht den Arzt einer Heilanstalt. Am liebsten hätte ich mich daraufhin selbst geohrfeigt, denn wenn ich schon einen halbwegs normalen Eindruck und nicht den eines komplett durchgeknallten Menschen vermitteln wollte, dann hatte ich das möglicherweise schon durch meine erste Reaktion vergeigt.
»Guten Tag, Herr … äh, Dr. Jantzen«, beeilte ich mich daher zu erwidern. Ich freute mich, dass ich seinen Namen nicht vergessen hatte, und hoffte, die Scharte wieder ausgewetzt zu haben, indem ich ihn namentlich ansprach. Würde sich eine echte Wahnsinnige überhaupt die Mühe machen, sich den Namen zu merken und den Doktor korrekt anzusprechen? Wohl kaum!
Der Arzt hatte die Akte noch immer aufgeschlagen vor sich liegen und seine Ellbogen rechts und links davon auf die Tischplatte aufgestützt, sodass sich die Spitzen seiner Finger über den Unterlagen trafen und seine Handflächen ein Zelt bildeten. Auf dessen Spitze hatte er seine breite, fleischige Nase gelegt, als wäre sie ihm zu schwer geworden. Seine grünen Augen wurden durch die Gläser seiner rahmenlosen Brille vergrößert und musterten mich abschätzend, sodass ich mir für einen Moment vorkam, als wäre ich ein winziges Pantoffeltierchen und würde durch das Okular eines riesigen Mikroskops betrachtet werden. Dann räusperte sich Dr. Jantzen laut, als würde er sich auf einen längeren Vortrag vorbereiten, und brach damit den Bann. Er löste die Hände voneinander und griff, während er mit der linken durch seinen sandfarbenen, von grauen Strähnen durchzogenen Vollbart strich, mit der rechten Hand nach einem Kugelschreiber, um sich vermutlich während des Gesprächs Notizen zu machen.
»Frau Dorn. Ich bin Dr. Stefan Jantzen, Facharzt sowohl für Neurologie und Psychiatrie als auch für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Gleichzeitig bin ich der Leiter dieser Abteilung des psychiatrischen Privatsanatoriums Dr. Straub.«
Ich war mir sicher, dass Dr. Jantzen diesen kleinen Vortrag über seine Qualifikationen jedem seiner Patienten hielt, dennoch leierte er die Worte nicht einfach herunter, sondern sprach ernst und eindringlich mit mir, als wären die beiden Sätze für mich von existenzieller Bedeutung. Und ich hörte ihm auch ebenso aufmerksam zu, denn in meiner gegenwärtigen Situation war ich für jeden Fetzen an Information dankbar, der mir dabei half, das gefräßige schwarze Loch in meinem Schädel wieder aufzufüllen. Was Dr. Jantzen mir bis jetzt gesagt hatte, waren zwar nur allgemeine Informationen über seine eigene Person, seine Funktion und meinen Aufenthaltsort, doch ich hoffte, dass im Laufe unserer Unterredung auch Informationen über mich folgen würden. Gegebenenfalls musste ich den Arzt gezielt danach fragen, doch ich hatte das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen war. Also hielt ich mich zurück und übte mich weiterhin in Geduld.
Dr. Jantzen blätterte kurz in der Akte, als würde er nach bestimmten Informationen suchen, und fuhr dann fort: »Sie wurden vor vier Tagen, am frühen Sonntagmorgen um 4:38 Uhr eingeliefert, nachdem man Sie in einem verwirrten und aggressiven Zustand aufgegriffen hatte. Auch nach der Aufnahme durch den diensthabenden Arzt verhielten Sie sich weiterhin äußerst aggressiv und griffen jeden an, der Ihnen zu nahe kam. Aus diesem Grund wurden Sie medikamentös ruhiggestellt und überwacht. Danach erfolgte die ärztliche Aufnahmeuntersuchung. Sie waren körperlich unversehrt, in Ihrem Blut wurde jedoch eine starke Konzentration verschiedener halluzinogen wirkender Substanzen festgestellt. Sie konnten weder Ihren Namen nennen, noch waren Sie in der Lage, auf einfachste Fragen zu antworten. Der diensthabende Arzt schrieb in den Aufnahmebogen, dass Sie sich wie ein wildes Tier gebärdeten. Sie knurrten und schrien unartikuliert, schlugen um sich, kratzten und bissen sogar zu. Ein Pfleger und eine Schwester mussten wegen Bissverletzungen, die Sie ihnen zugefügt haben, sogar ärztlich behandelt werden. In dieser Hinsicht kann ich Sie allerdings beruhigen, denn es handelte sich um keine schwerwiegenden Verletzungen.«