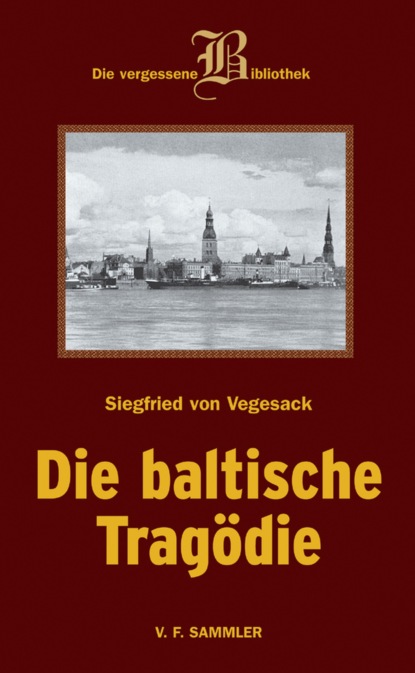
Полная версия:
Siegfried von Vegesack Die baltische Tragödie
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Zentrales Thema der „Baltischen Tragödie“ ist der Verlust. Immer wieder muß Aurel gerade das verlieren, wozu er seine Zuneigung entfalten möchte, eine Bindung aufbauen kann – seien es nun Haustiere oder geliebte Menschen. Bereits der erste Band ist geprägt durch diese einschneidende, schmerzhafte Erfahrung: Ihm entschwinden besonders jene, die er am meisten liebt: seine Amme, der Hauslehrer oder der beste Freund. So wird dem sensiblen, verschlossenen Knaben ein Sich-Öffnen nur schwer möglich. Schließlich ist es der Tod des Vaters, der zum Begreifen des Endgültigen, des „Nie wieder“ führt.
Zeitlebens ist der Autor dieser Trilogie mit der Verarbeitung des Heimatverlusts beschäftigt. Noch auf der anderen Halbkugel der Welt, ein halbes Jahrhundert nach seinem Aufbruch, wird er wiederholt vom alten Blumbergshof träumen, wie ein aufgewühlter Brief vom April 1960 an seine Nichte bezeugt. Immer wieder ist Siegfried von Vegesack an den Ort, dem er sich so sehr verbunden gefühlt hat – nach Blumbergshof – zurückgekehrt: 1933, 1935, 1938, 1939 und zuletzt, in ein längst zweckentfremdetes und fremdes Haus, als Wehrmachtsdolmetscher im Zweiten Weltkrieg. Danach ist es nicht mehr möglich. „Was frommt es, dem Verlor’nen nachzuklagen?“ fragt er in „Das Unverlierbare“, das zusammen mit einer Reihe anderer Gedichte über seine unverlierbar-verlorene Heimat in wenigen Sommertagen des Jahres 1946 entstanden ist:
Um das Verlor’ne klagen nur die Toren…
Viel tiefer noch, als du es je besessen,
bewahrt’s das Herz und wird es nie vergessen:
Nur das ist unverlierbar, was du ganz verloren!
„Die Baltische Tragödie“ ist wohl der Roman zur Geschichte der Deutschen im Baltikum. Zu Beginn der NS-Zeit geschrieben, ist er trotz seines Erscheinungsdatums ein Appell an Toleranz und Verständigung zwischen den Mitgliedern verschiedener Volksgruppen. Ohne Pathos und Anklage, bis in Einzelheiten dokumentarisch getreu, zeichnet Vegesack die geschichtlichen Entwicklungen nach. Dennoch wird seine Trilogie – insbesondere wegen ihres politischen dritten Teils – nach dem Zweiten Weltkrieg mit Rücksicht auf die sowjetische und französische Zensur zunächst nicht wiederaufgelegt werden: Erst 1949 kommt es unter dem Titel „Versunkene Welt“ zur Neuausgabe des ersten Bandes; der „Totentanz in Livland“ (1935) und die einbändige Ausgabe der „Baltischen Tragödie“ von 1936 befinden sich in der Sowjetischen Besatzungszone 1946 gar auf der „Liste der auszusondernden Literatur“.
Die baltische Schicksalsfrage läßt Vegesack nicht mehr los, erstmals sucht er auch ihre unmittelbare Gegenwart dichterisch aufzuarbeiten, plant Anfang 1939 einen vierten Band. In ihm läßt er die im Baltikum verbliebenen Familienangehörigen des Aurel von Heidenkamp das Fazit ziehen: „Wir haben etwas geleistet, was am allerschwersten ist: wir haben wieder von vorne angefangen. Wir haben nicht die Hände in den Schoß gelegt und unserer großartigen Vergangenheit wehmütig nachgetrauert – wir haben zugepackt, wir haben uns ein neues, wenn auch sehr bescheidenes, aber doch eigenes Dasein geschaffen.“
„Ich machte mich an die Arbeit und habe in Weißenstein 1940 den ‚Letzten Akt‘ der ‚Baltischen Tragödie‘ geschrieben“, notiert der Dichter in seinem ungedruckt gebliebenen Rechenschaftsbericht „Wie ich die zwölf Jahre erlebte“. Wie die ehemaligen „Großherren“ nach der Güterenteignung von 1917 sich vergeblich um die Erhaltung ihrer „Restgüter“ bemühen, bis sie – wie sein älterer Bruder Manfred, das Vorbild für die Figur des Reinhard in dem Gesamtzyklus – durch die Zwangsumsiedlung ins Dritte Reich in den ersten Kriegsjahren die Heimat endgültig aufgeben müssen, ist das Thema dieses selbständigen Fortsetzungsbandes. Gewidmet ist „Der letzte Akt“ „allen Müttern, Vätern und Kindern aller Völker, die ihre Heimat verloren“. Der Autor verteidigt ihn in einem Brief an seinen Lektor vom Januar 1941: „Sicher gibt dieses Buch kein vollständiges, vielleicht auch einseitiges Bild vom Aufbruch der Balten – jedenfalls aber ein Bild, das der Wahrheit näher kommen dürfte, als das, was unsere Zeitungen, auf Befehl des Propagandaministeriums, dem deutschen Leser, wie Sie ganz richtig sagen, ‚in die Ohren gebrüllt haben‘ – von einem ‚geschlossenen Heim-Wollen ins Reich‘ kann bei uns Balten ebenso wenig die Rede sein wie bei den Südtirolern!
Mir kam es vor allem darauf an, den rein menschlichen Konflikt darzustellen, den die Balten jetzt durchmachen underleiden mußten, den Konflikt zwischen Heimatliebe und Treue zum eigenen Volk.“ In seinem Rechenschaftsbericht erzählt er weiter: „Die Kölnische Zeitung hat 1941 den Roman unter dem Titel ‚Und wenn sie nicht gestorben sind‘ als Vorabdruck veröffentlicht. Der Schünemann-Verlag wollte das Buch aber nur unter der Bedingung bringen, wenn das Manuskript völlig umgearbeitet und den damaligen Ansichten angepaßt würde – was ich natürlich ablehnte. Ich hatte über diese sogenannte ‚Umsiedlung‘ meine eigenen Gedanken, die ich in keinem Fall der damals propagierten ‚Heimkehr ins Reich‘ anpassen konnte. So ist ‚Der letzte Akt‘ erst lange nach dem Krieg – 1958 im Salzer Verlag – erschienen.“
Wiederholt hat sich Siegfried von Vegesack der Propaganda der Nationalsozialisten widersetzt – etwa, wenn er sich weigert, einen Glückwunsch der „Reichsschrifttumskammer“ zu Goebbels Geburtstag zu unterschreiben. Auch ihr Verlangen nach einer schriftlichen Erklärung, „stets für die Deutsche Dichtung im Sinne der Nationalen Regierung“ einzutreten, lehnt er mehrfach ab – mit Erfolg. Doch erst in jüngster Zeit hat die Literaturwissenschaft den Baltendeutschen vereinzelt den Vertretern der Inneren Emigration zugerechnet. „Als Mitglied der Paneuropäischen Union und der internationalen Künstlervereinigung Porza war ich schon längst der Partei ein Dorn im Auge“, kommentiert er seine frühe Verhaftung im März 1933. Dieser Künstlervereinigung haben die Eheleute von 1929 bis 1932 ihren Turm verpachtet; sie ziehen ins Tessin. Nur als Gäste kehren sie zeitweilig auf ihr Grundstück zurück. Vegesacks Wunsch, einer Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, sowie sein ausgeprägtes „Fernweh“ treiben ihn hinaus in die Weite: außer ins Tessin und ins Baltikum nach Schweden, Südtirol, Dalmatien und – Südamerika.
In Argentinien lebt nämlich „Nena“, Siegfried von Vegesacks – bis zu seinem Lebensende zumeist ferne – Geliebte. Dreimal – 1936–38, 1959–60 und 1965–66, noch mit 78 Jahren, wird er sie dort besuchen. Nicht von ungefähr heißt auch in der „Baltischen Tragödie“ eine von Aurels italienischen Spielgefährtinnen ‚Nena‘. Kennengelernt haben sie einander im Herbst 1929 in Lugano. Von Clara Nordström hat er sich bereits getrennt, auch wenn die Ehe erst 1935 geschieden wird: „Zuerst die Anthroposophie, und nun die Rassenseuche haben uns immer mehr entfremdet“, schreibt er Alfred Kubin im Mai 1935 über die Schwedin, die nach dem Krieg zum Katholizismus konvertieren wird. Nena – ihr richtiger Name lautet Lea de Loeb – ist Halbjüdin, geschieden und neun Jahre jünger als Vegesack; sie zieht im Februar 1932 mit ihren Kindern zu den Eltern nach Argentinien, wohin diese ausgewandert sind.
Weinend läuft der dreizehnjährige Gotthard dem Vater auf dem Bahnsteig bei dessen Abreise nach Südamerika im September 1936 neben dem abfahrenden Zug nach. Er hatte ihm zuvor einen Zettel in die Jackentasche gesteckt, den dieser aber erst in Argentinien entdeckt: „Komm bald zurück, ich brauche Dich sehr!“ Nach fünf Jahren sehen die Liebenden einander wieder; Vegesack trifft Nena in Montevideo. Ihm ist, „als wären wir nie getrennt gewesen.“
„Von diesen Wochen habe ich gezehrt, und davon lebe ich noch heute“,schreibt er 1967 in der „Überfahrt“, der Bilanz seines Lebens. Warum ist der Dichter nicht bei Nena geblieben? Er erzählt es in seinem Roman: „Und dann – die Nacht in der Pampilla. Weißt Du noch? Ich erinnere mich an alles. Wir waren hinaufgeritten – zu ‚meinem‘ Häuschen, einem alten Gemäuer, das verlassen über der Quebrada stand. Ich träumte davon, es mir als mein Zuhause einzurichten, und wollte es Dir zeigen. […] Wir ließen die Pferde im Freien grasen, saßen auf der steinernen Schwelle und schauten, wie der Feuerball in die Sierra versank. Als es dunkelte, gingen wir hinein. Ich hatte uns ein Lager bereitet.
Beim Abstreifen meiner alten Windjacke griff ich in die Tasche. Da kam der Zettel meines Jungen zum Vorschein. Ich gab ihn Dir. Du lasest ihn und sagtest kein Wort. […] Mitten in der Nacht wachte ich auf. Die Cresciente? Nein. Du schluchztest. Noch nie hatte ich Dich weinen gesehen. Ratlos saß ich da und begriff nichts. Der Mond, der über dem Gemäuer aufgegangen war, schien auf Dein Gesicht, über das unaufhörlich Tränen liefen. Und dann sagtest Du: ‚Nein – du mußt zurück. Du kannst den Jungen nicht im Stich lassen. Unser Glück wäre zu teuer erkauft. Wir müssen verzichten…‘
In jener Nacht fielen alle meine Träume zusammen. Du hattest recht. Du kanntest mich besser als ich mich. Du dachtest an mich – und nicht an Dich. Ich konnte nicht bei Dir bleiben – ich mußte zurück…“ – Ein seltsam verdichtetes Zusammenspiel, denn auch von Gotthard, seinem ersten Sohn, soll er bald Abschied nehmen: 1944, erst zwanzigjährig, ist Gotthard von Vegesack in Polen als Flieger gefallen. Als Nachruf erscheint 1947 Vegesacks Gedichtsammlung „Mein Junge“, in der er seiner Trauer Ausdruck gibt.
Im Mai 1938 reist der Dichter zurück nach Deutschland, nutzt die knapp zweijährige Tätigkeit als Auslandskorrespondent für seinen ersten Reisebericht „Unter fremden Sternen“ (1938). „Es war ein großes Glück für mich, daß ich noch kurz vor Tores-Schluß so viel von der Welt sehen und mich mit unvergeßlichen Eindrücken vollpumpen konnte“, schreibt Vegesack im März 1940 an Kubin. „Sie tragen Ihre Welt in sich und brauchen deshalb nur aus Ihrem Innern zu schöpfen; bei mir ist das anders: ich muß mir alles hereinholen, muß die Dinge leibhaftig sehen, damit sie im Innern lebendig werden! Aber nun bin ich für Jahre versorgt!“ Erzählungen aus Argentinien (1940), Paraguay (1941), Chile (1942) und Brasilien (1947) entstehen. Stets bildet die Grundstimmung immer wiederkehrender Schwermut und Melancholie den fruchtbaren Boden für Vegesacks Humor. Die Liebesgedichte, die der Bewunderer Schopenhauers über Nena schreibt, sind „durchzogen vom Wissen um die Zerbrechlichkeit des Glücks, aber immer wieder auch erfüllt von jener Weisheit des Heimatlosen, den sein entwurzeltes Leben lehrte, daß man nur das besitzt, was man ganz verlor: das vollkommen Verinnerlichte. So wird auch verinnerlichte Liebe selbst durch Ozeane nicht getrennt“, schreibt Franz Baumer – es sind melancholische Liebesgedichte. Für Vegesacks zweite Frau Gabriele, „Jella“ genannt, ist das Ertragen seiner Zerrissenheit sicher nicht leicht: Von Anfang an hat sie von seiner fernen Liebe gewußt, nie aber geglaubt, daß diese so unauslöschlich sein würde. „So ganz allein im Turm – das ging doch nicht auf die Dauer. Meine zukünftige Frau […] ist ein lieber, warmer, völlig unkomplizierter Mensch – gerade das, was ich brauche!“ schwärmt der Ledige: „So wird nun im Turm ein neues Leben beginnen – ich wollte fort, aber er läßt mich nicht los, und nun werden sogar neue Wurzeln geschlagen. Ich habe das Gefühl, daß ich Ihrem Beispiel folgen, mich immer tiefer hier vergraben und von der Welt da draußen abschließen werde. Aber dazu braucht man einen Menschen, der die Einsamkeit teilt, – sonst erfriert man. Und ich glaube, daß ich diesen Menschen gefunden habe!“ schreibt er am 1. März 1940 an Kubin. Im April heiratet er Jella, die Tochter eines Obersten aus Würzburg, zum Jahresende wird ihr gemeinsamer Sohn Christoph geboren.
Doch bald schon ist Vegesack von der Familie getrennt: „Als der Krieg im Osten ausbrach, meldete ich mich […] freiwillig als Dolmetscher“, erzählt er in seinem Rechenschaftsbericht. Im Mai 1942 setzt ihn ein Flugzeug in Poltawa ab; von dort aus trampt der 54jährige „ohne Auto und keinem Vorgesetzten unterstellt, kreuz und quer, meist in Lastwägen oder Güterzügen, im Süden bis in die Krim und den Kaukasus, und im Norden nach Reval und Narwa hinauf“. Als „Sonderführer“ kommt er in die Ukraine, nach Georgien, schließlich auch in die alte Heimat: „Als Dolmetscher im Osten hatte ich mich anfangs noch einigen Illusionen hingegeben. Doch mit der Zeit wurden meine Eindrücke immer skeptischer. Im Frühjahr 1944 erhielt ich vom damaligen Chef des Wirtschafts-Stabes-Ost – General Stapf – den Auftrag, auf Grund meiner Berichte und eines umfangreichen Materials von Dokumenten, die mir zur Verfügung gestellt wurden, eine Denkschrift über die ‚Behandlung der Bevölkerung‘ in den von uns besetzten Gebieten zu schreiben, und zwar so, wie ich die Dinge sehe, ohne jede Rücksicht auf höhere Dienststellen. Einzelheiten dieser Denkschrift hatte ich mit Graf Peter Yorck von Warthenberg besprochen, der bei uns im Stab tätig war.
Am 17. Juli 1944 lieferte ich meine Denkschrift in Berlin ab. Schon am nächsten Tag empfing mich General Stapf mit den Worten: ‚Wissen Sie, was Sie da geschrieben haben? Eine furchtbare Anklage!‘
Ich erklärte dem General, daß ich meine Denkschrift so geschrieben hätte, wie es mir befohlen war: ohne jede Rücksicht, so wie ich die Dinge sehe. Den 20. Juli erlebte ich in Berlin. Gleich darauf wurde ich von General Stapf nach Weißenstein beurlaubt.
Erst später habe ich erfahren, daß General Stapf mit Graf Yorck von Warthenberg zu den Verschwörern gehörte und daß meine Denkschrift gleich nach geglücktem Attentat veröffentlicht werden sollte. Im letzten Augenblick, als General Stapf am 20. Juli sich in die Bendlerstrasse zu Graf Yorck begeben wollte, wurde er gewarnt, so daß er zu Hause blieb und meine Denkschrift nicht in die Hände der Gestapo gefallen ist. Später bin ich zwar von der Gestapo in Regensburg verhört worden, aber man konnte mir nichts nachweisen. Graf Peter Yorck wurde hingerichtet. Im Oktober 1944 nahm ich meinen Abschied.“
Sein erstaunlich unabhängiger und deutlich kritischer Bericht „Als Dolmetscher im Osten. Ein Erlebnisbericht aus den Jahren 1942–43“ kann erst 1965 erscheinen. „Bei der Aussicht, die eine Gewaltherrschaft (der Bolschewiken) nur durch eine andere (die deutsche) zu vertauschen, zu einer deutschen Kolonie herabzusinken und als ‚weiße Neger‘ und ‚Untermenschen‘ für den deutschen Herrn zu schuften, war es kein Wunder, daß auch die deutschfreundlichen Elemente, die uns mit Begeisterung als Befreier begrüßt hatten, in kurzer Zeit alle Sympathie für uns verloren und wieder dem Bolschewismus zugetrieben wurden. […] Man kann kein Volk gewinnen, wenn man ihm ständig seine Minderwertigkeit vor die Nase hält, ganz abgesehen davon, daß diese Völker alles andere als minderwertig sind“, heißt es in seinem von Paul Rohrbach, dem politischen Schriftsteller, als „Geheimschrift“ gewürdigten Text.
Auch als Dichter setzt Vegesack sich mit der Herrschaft der Nationalsozialisten auseinander; als Versuch, ihren Aufstieg und die ungeheure Zustimmung in Deutschland für Adolf Hitler zu erklären, entsteht im Februar 1946 „Das Weltgericht von Pisa“ – eine von Thomas Mann lobend hervorgehobene Erzählung, die sich mit der Schuldfrage befaßt.
Gerhard Storz, der Präsident der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung, in die der Balte 1956 berufen worden war, würdigt in einer Festschrift zu Vegesacks 80. Geburtstag die moralische Autorität und Integrität dieses Mannes: „Er hat sie sich erworben, weil er an das Gute im Menschen glaubt“. Nicht nur die Stadt Regen hat den Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet, indem sie ihn zu ihrem Ehrenbürger macht: 1961 erhält er den Literaturpreis und 1973 die Ehrengabe der Stiftung zur Förderung des Schrifttums, 1963 den Ostdeutschen Kulturpreis der Künstlergilde Esslingen. Anläßlich der Verleihung des letzteren verliest er sein Glaubens-„Bekenntnis“: „Mag es auf unserem kleinen Planeten auch wie in einem Tollhaus zugehen, so glaube ich doch, allem Niedrigen und Niederträchtigen zum Trotz, an das Gute im Menschen, an seine Bestimmung, an den Sinn und den Wert dessen, was das Leben lebenswert macht: an Tapferkeit, Ritterlichkeit, Duldsamkeit, Treue und Lauterkeit der Gesinnung, an die große, den ganzen Erdball umspannende Kameradschaft und Brüderlichkeit aller, die guten Willens sind.“
Noch weiter, über die früheste Kindheit hinaus, verfolgt er nun die eigene Lebensspur zurück. 1960 ergänzt Vegesack seine ‚Trilogie mit Nachspiel‘ um eine Vorgeschichte: „Vorfahren und Nachkommen“. Seine „Aufzeichnungen aus einer altlivländischen Brieflade 1669–1887“ sind die über den Zweiten Weltkrieg von einem Bruder nach Deutschland geretteten Briefe der Freiherren von Campenhausen, seiner Vorfahren mütterlicherseits, die auch in den Ahnenporträts in der „Baltischen Tragödie“ bereits auftauchen. Ein reiches politisches und kulturgeschichtliches Panorama entfaltet Vegesack darin, das – wie er im Februar 1960 Werner Illing aus Argentinien schreibt – „aus der Perspektive eines livländischen Gutshofes […] Pietismus, Aufklärung, Französische Revolution, Napoleon, Befreiungskriege, Biedermann-Zeit usw.“ widerspiegelt.
Bis zuletzt erweitert der Dichter den Erzählkreis seiner baltischen Welt: Nach seinen „Altlivländischen Idyllen“ („Der Pastoratshase“, 1957) erscheinen 1965 seine „Baltischen Erzählungen“ sowie ein Jahr zuvor das Hörspiel „Die Liebeserklärung“ – in welchem sich die beiden wichtigsten Hauptfiguren seiner Romane, Aurel von Heidenkamp und der Baron Kai von Torklus, in einem Altersheim voller Baltendeutscher begegnen – und zuletzt, 1970, seine liebevoll-amüsanten Porträtskizzen „Die Welt war voller Tanten“.
In „Jaschka und Janne“ (1965) erzählt Vegesack erstmals von einer Überwindung der „gläsernen Wand“, von einer Liebe in der Universitätsstadt Dorpat über die Volksgrenzen hinweg. Unterschwellig kontrastiert er zudem die Lebensschwäche deutschbaltischer Herren und die Tüchtigkeit und Vitalität der einheimischen Esten: Jaschka, dem deutschen Bummelstudenten und künftigen Majoratsherrn, gelingt es, die kleine estnische Näherin Janne, gegen alle Vorurteile zu ehelichen, und gemeinsam durchleben sie die bewegten Stationen der baltischen Geschichte: Enteignung, Umsiedlung und Verschleppung durch die Bolschewiken. „Natürlich sind es baltische Erinnerungen“, schreibt Vegesack am 6. Oktober 1965 über seine jüngst erschienenen Erzählungen an Nena, „da ich ja dort aufgewachsen bin, aber beide Erzählungen erweitern und vertiefen das ‚Baltische‘ meiner Balt. Tragödie ins Allgemein-Menschliche, sind also keineswegs ‚Wiederholungen‘! Die ‚Baltische Tragödie‘ mußte ich doch so schreiben, wie ich sie erlebt habe: die Letten und Esten blieben im Hintergrund, und die Russen waren unsere ‚Feinde‘, da ich ja mitten in der Russifizierung aufgewachsen bin. In ‚Jaschka und Janne‘ versuche ich unser gemeinsames Schicksal mit den Letten und Esten darzustellen – die es ja viel schlimmer haben als wir Deutsch-Balten, da sie mit der Heimat auch ihren Sprachraum verlieren. […] Und in der ‚Hochzeit‘ wird das gute deutsch-russische Verhältnis dargestellt, das ja vor der Russifizierung bestand: die ‚russische‘ Zeit war ja vor der Russifizierung die glücklichste und friedlichste, die wir Balten gehabt haben!“
Nur für kurze Vortragsreisen unterbricht der baltische Poet sein zurückgezogenes, arbeitsreiches Dasein. Über siebzig selbständige Werke hat er im Laufe seines Lebens geschaffen. „Ich habe nie irgendeiner Gruppe, einer Richtung oder irgendeinem –ismus angehört“, sagt er über sich und seine Literatur, „aber man muß natürlich bestimmte Leitbilder haben“: Die seinigen sind Jean Paul und Adalbert Stifter; unter seinen Zeitgenossen verehrt er daneben „Knut Hamsun, den Norweger, und bei den Deutschen Thomas Mann“.
In den fünfziger und sechziger Jahren arbeitet er bevorzugt für den Hörfunk, wo er seine Texte zum größten Teil selbst lesen kann. Werner Grüb, der damalige Abteilungsleiter des Süddeutschen Rundfunks, erinnert sich an das Erscheinungsbild des Gealterten: „Als er mein Zimmer betrat, stand der Dichter der ‚Baltischen Tragödie‘ leibhaftig vor mir: Ein Mann um die Fünfundsiebzig in einem Anzug, der möglicherweise einmal bessere Tage gesehen hatte, ein Mann mit einem Gesicht, das leidvolle Erlebnisse spiegelte und sich zugleich über sie zu mokieren schien, ein Gesicht, das nicht von Falten des Alters, sondern von Runen eines Schicksals geprägt war, das seine Spuren tief eingekerbt hatte; und der Mann, der diese Spuren mit unverkennbarem Stolz zur Schau trug.“
„Was und wie die Welt auch sei, / unentwirrt und unentwirrbar, / bleibe dir nur selber treu: / unbeirrt und unbeirrbar!“ lautet Vegesacks Motto über alle Zeiten hinweg. Längst sind er und die Einheimischen, die ihn anfangs als den ‚g’spinnaten Baron‘ bezeichnet haben, gute Nachbarn. Als scharfer Beobachter seiner Umwelt hat er sie und ihren kargen Alltag porträtiert, erstmals 1942 in seiner Erzählung „Das Dorf am Pfahl“ – auf diesem Quarzgang, der den Bayerischen Wald durchzieht, führt der Weg vom Turm des Dichters über die ehemalige Zugbrücke hinaus. Vom Leben im „Fressenden Haus“ nach dem Zweiten Weltkrieg gibt der Schriftsteller Georg Britting, der ihn Ende August 1953 besucht, ein anschauliches Bild: „Ich ging zu ihm hinauf nach Weißenstein (3/4 Stunden steiler Anstieg), und er schleppte mich weitere zwei Stunden entlang des ‚Pfahl‘, und wir landeten in seinem Turm, wo die vier Brüder Vegesack hausen, drei davon tragen ein Monokel, Siegfried ist 65, die anderen 70, 73, 79, reizende baltische Barone und drei Frauen und 6–7 Kinder und Enkel, aber gar nicht bohèmisch, mit Ziegen, Kühen, Hasen, Obstgarten, 4 Hunden. Jeder der Brüder eine 3-Zimmerwohnung, so geräumig ist der Turm!“ Noch immer haust er in seinem „alten Gemäuer – mehr Ruine als Haus“, in dem nur zwei Räume, das Wohnzimmer und sein Arbeitszimmer „mit Mühe und Not“ beheizbar sind, und wo selbst das Wasser keine Selbstverständlichkeit ist: „Bei starkem Frost oder großer Dürre mußte ich es früher oft Wochen lang in Eimern von der Quelle herschleppen, was besonders im Winter, wenn man das Eis aufhacken mußte, kein Vergnügen war“, schreibt er im Februar 1963 seinem Regisseur im Bayerischen Rundfunk.
Vegesacks Hilfsbereitschaft kennt fast keine Grenzen, nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergt er zahlreiche Flüchtlinge und Verwandte aus Ostdeutschland in seinem Turm – seine Ehefrau hat es nicht immer leicht: „Zu Weihnachten erhält sie oft nur selbstgezeichnete Gutscheine des Gatten, auf denen alle die schönen Dinge abgebildet sind, die er ihr, sobald wieder genügend Geld im Hause ist, schenken wird“, weiß Franz Baumer, der die bislang einzige Vegesack-Biographie geschrieben hat.
Zeitlebens bleibt Vegesack bestrebt, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Aus ihr speist sich die Inspiration für sein Werk: „Ich kann nicht im Zimmer sitzen und meine Sachen ausbrüten. Ich muß hinaus in die freie Natur, in den Wald, ich muß Nadelboden unter den Füßen haben, Bäume neben mir, Wolken über mir, und wenn ich dann auch später zurück zum Schreibtisch gehe: das Beste fällt mir doch erst beim Wandern ein.“ Noch als 80jähriger fährt er im Winter auf Skiern hinunter nach Regen. Nie hat er ein Auto besessen – und es nie vermißt. Der „rollende Blechkasten“ ist ihm nur das fehlgeleitete Wunschbild „dieser neuen Zeit und ihrer Menschen, die ihr Dasein nicht im Da-sein, sondern nur noch in einer möglichst schnellen Fortbewegung genießen können, in einer Fluchtbewegung, fort von sich selbst.“ Lieber bleibt er zu Hause und genießt in Erinnerung an Südamerika seinen Mate aus seiner silbernen Bombilla, wie es bereits seit den dreißiger Jahren sein morgendlicher Brauch ist. Siegfried von Vegesack – der Umweltschützer: 1958 protestiert er, zusammen mit vielen anderen deutschen Autoren von Ilse Aichinger bis Martin Walser, in einem Aufruf „Gegen die atomare Bewaffnung“ der Bundeswehr; als Gegner des Quarzabbaus im Bayerischen Wald setzt er sich für den Erhalt des Pfahls ein, wehrt sich gegen die Errichtung einer Müllhalde und gegen die Bausünden der sechziger Jahre.
„Was hat mich eigentlich hier festgehalten?“ sinniert der 75jährige in dem über ihn gedrehten Fernsehfilm. „Diese Landschaft, das Land, die sind doch hier ganz anders als in meiner alten Heimat in Livland. Und doch: etwas Gemeinsames haben beide: diese Weiträumigkeit, den weiten Horizont und den Wald.“ So ist ihm auch der Bayerische Wald zur vertrauten Atmosphäre geworden. „Hier spürst du“, schreibt er ein anderes Mal, „umwittert vom Spuk, noch einen Hauch der Urzeit, den Atem natürlichen Bodens. Wenn deine Seele krank ist, dann verbirg dich, wie ein verwundetes Tier, in den Wäldern: sie werden dich heilen.“ Vielleicht auch deshalb verspürt er ein Unbehagen davor, einmal auf einem „alljemeinen Friedhof“ liegen zu müssen, wie er seinen Freunden regelmäßig mit dem melodisch-schwingenden Tonfall seiner baltendeutschen Mundart anvertraut.