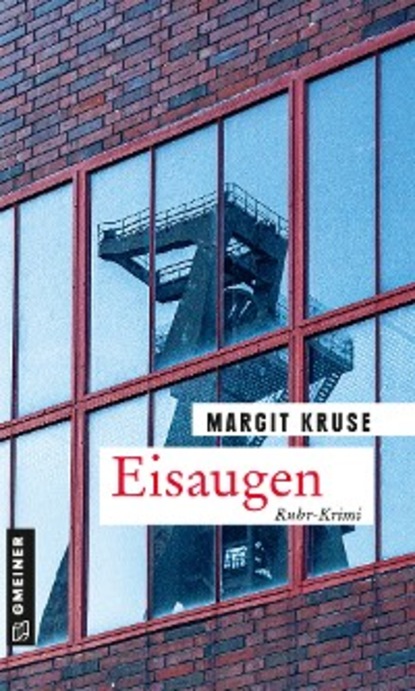
Полная версия:
Margit Kruse Eisaugen
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Mitleid! Mitleid war auf jeden Fall im Spiel, als sie vorgestern Abend während einer dieser Heißhungerattacken, welche sie ständig kurz vor ihrer Periode quälten, zur nächstbesten Bude rannte, um sich etwas Süßes zu kaufen, und auf ihn traf. Er stand lässig am Tresen gelehnt, vor Marshmallowmäusen, Lakritzschnecken und Gummiteufeln. In der einen Hand ein Mettbrötchen, welches ekeliger nicht aussehen konnte, in der anderen eine Flasche Bier. Seinen seriösen Plüschmantel hatte er gegen eine braune Strickjacke eingetauscht. Er lachte sie mit geschlossenem Mund freundlich an. Seine Augen strahlten. Als der Chef der Bude nach hinten ging, um ihr Eis aus der Truhe zu holen, brachte er tatsächlich den Mut auf, sie anzusprechen.
»Ist traurig mit dieser jungen Frau, näh?« Er ging davon aus, dass jeder von der Toten vom Friedhof wissen müsse.
»Ja, schlimm«, antwortete Margareta. Sie war geschockt, dass er sie ansprach. Das waren in den 35 Jahren, in denen sie ihn kannte, die ersten Worte, die er an sie richtete. Und es sollte noch schlimmer kommen.
»Darf ich Sie zum Essen einladen, Karfreitag? Ich wohne hier oben!« Er deutete mit der Bierflasche zu den Fenstern seiner Wohnung hinauf.
»Ich weiß«, sagte sie nur und suchte in ihrem Gehirn schnell und gründlich nach einer plausibel klingenden, nicht verletzend wirkenden Ausrede. Doch er starrte sie voller Angst aus seinen kalt blickenden Eisaugen an. Ich habe noch nie so winzige Pupillen gesehen, dachte sie einen letzten klaren Gedanken, bevor sie aussprach, was sie selbst kaum glauben konnte.
»Ja, wieso nicht!«
»12 Uhr?«, fragte er sie hektisch mit belegter Stimme. Seine Hände zitterten so stark, dass die Zwiebelstückchen seines Mettbrötchens zu Boden fielen.
Mitleid ließ sie erneut »Ja« sagen.
Zu Hause angekommen zermarterte sie sich den ganzen Abend das Hirn, wieso sie nur diese unmögliche Essenseinladung annehmen konnte. War sie denn nach der Trennung von Bertl total durchgedreht? Zuerst ließ sie sich mit einem gar nicht vorhandenen polnischen Schuster ein, und nun kroch sie in die Wohnung eines Spähers, der nicht gerade prickelnd aussah. Sie nahm 20 Baldriantropfen und ging ins Bett. Ihre Heißhungerattacke war schlagartig verflogen.
Nun saß sie hier, nahm zögernd die alte Gabel mit den enorm langen Zinken in die Hand und begann zu essen. Na ja, bei dem Gericht konnte er nicht viel falsch machen. Schlemmerfilet aus dem Gefrierfach war Margaretas Verzweiflungsgericht A, wenn ihr nichts Besseres einfiel. Verzweiflungsgericht B war Miracoli, allerdings aufgepeppt mit 100 Gramm Gehacktem. Für alle Fälle gab es noch ein drittes Verzweiflungsgericht. Nämlich C: Zwiebel-Sahne-Hähnchen. Dieses Päckchengericht fand sie einfach praktisch. Jedoch würde sie nie jemandem, den sie zum Essen einlud, eines ihrer A-, B-, oder C-Gerichte vorsetzen.
Eisauge war allerdings stolz, überhaupt irgendetwas hinbekommen zu haben. Und der Fisch war sogar gut durch, stellte sie verblüfft fest. Also musste er lesen können und die Garzeit genau eingestellt haben. Dazu reichte er einen 98er-Chardonnay und sie wunderte sich, wie er an den Wein gekommen war. Sie tranken ihn zwar aus Wassergläsern der einfachsten Sorte, aber immerhin. Auch das Besteck hatte er richtig hingelegt, es lag sogar ein kleiner Löffel für den Nachtisch bereit. Apfelmus aus dem Glas. Auf eine Tischdecke hatte er verzichtet. Einzig Plastikunterlagen mit Entenmotiven zierten den alten Holztisch.
Sie saßen in seiner Wohnküche, eines seiner zwei Zimmer. Der Tisch stand mitten im Raum und trotzdem nahe am Fenster. Vier Stühle waren darum drapiert. An der Wand vor ihr stand ein Gelsenkirchener Barockschrank, daneben befanden sich die Spüle, der Herd sowie der Kühlschrank. Hinter ihr hatte ein altes Sofa seinen Platz, dicht davor ein Tischchen mit einem Fernsehgerät. Der Raum war zwar spartanisch eingerichtet, aber alles war sauber, worüber sie erstaunt war. Sie hoffte inständig, das Schlafzimmer nicht sehen zu müssen.
Wie lange muss man zu einer Mittagessenseinladung bleiben? Wann kann ich gehen, ohne unhöflich zu wirken? Diese Fragen geisterten in ihrem Kopf.
Er prostete ihr mit dem Chardonnay-Wasserglas zu.
»Ich heiße Karl-Heinz! Meine Freunde nennen mich Charly!« In seinem Blick lag so viel Freude, dass sie nicht anders konnte, als nett zu ihm zu sein. Das Helfersyndrom! Da war es wieder!
»Ich heiße Margareta!«, erwiderte sie und zwang sich, ihn freundlich anzusehen.
»So ein schöner Name!«, strahlte er sie an.
Beruhigt stellte sie fest, dass in seinem Mund Zähne vorhanden waren. Sie lagen zwar tiefer, als es normalerweise der Fall war – ein tiefer gelegtes Auto war für manche etwas Tolles –, aber immerhin hatte er welche. Trotzdem ein komischer Kerl.
Nachdem er eine halbe Flasche Chardonnay intus hatte, wurde er redseliger und berichtete ihr aus seinem bescheidenen Leben. Er ließ sie kaum zu Wort kommen und erzählte, während er das dünnflüssige Apfelmus schlürfend in sich aufsog, alles, was er schon längst mal jemandem mitteilen musste.
Wieso immer ich?, schrie eine Stimme in ihr. Wieso muss ich mir seine Lebensgeschichte anhören? Das kann doch alles nicht wahr sein! Wohin wird mich meine Gutmütigkeit noch bringen?
Als er anfing, Details von seiner Tätigkeit als Leichenwäscher, damals, vor zehn Jahren, zu erzählen und ihr Fotos von besonders schönen Leichen zeigen wollte, stand sie abrupt auf und verabschiedete sich unter dem Vorwand, zu ihrer Mutter zu müssen.
Wenn Waltraud wüsste, mit wem sie heute gespeist hatte, sie würde einen Anfall bekommen und ihre Tochter für verrückt erklären. Immerhin war Margareta so schlau, ihr Hirn einzuschalten, um bloß keine Gegeneinladung auszusprechen. Zu Ostern vielleicht? Fest der Freude und Fruchtbarkeit! Oh nein, genug der Barmherzigkeit!
Sie machte sich unmittelbar auf den Weg zu ihren Eltern. Sie brauchte jetzt einfach Abwechslung. Einen Kontrast zu diesem Idyll. Auch auf die Gefahr hin, dass wieder mal der Leichenfund auf dem Friedhof durchgekaut werden würde.
Als sie in das verräucherte Wohnzimmer ihrer Eltern kam, dachte sie, sie betrete eine Kneipe zu bester Stunde. Alle redeten gleichzeitig, euphorisch laut, schienen auf Drogen zu sein. Auf dem altdeutschen Mohairsofa saß in der Mitte ihr Vater, rechts daneben ihr Bruder Gisbert, links seine Frau Heidrun. Auf der kleinen Zweiercouch unter dem Fenster ihr Neffe, der ganz nach seiner Mutti kam, daneben Irene Walter, die Nachbarin. Auf dem Sessel gegenüber, in einem weißen Arztkittel – wo sie den bloß wieder herhatte –, Margaretas Mutter.
Die Halbglatze ihres Vaters glänzte wie eine in Öl geröstete Erdnuss. Sein weißes Oberhemd spannte über seinem Bauch, den er stolz herausstreckte. Er übertönte mit seiner sonoren Stimme die anderen, fuhr, wie immer, wenn er einen sitzen hatte, den anderen über den Mund, wusste alles besser, hatte alles selbst schon mal erlebt. Sie fragte sich, was an so einem Feiertag, im Kreise der Familie, die Nachbarin Irene Walter hier verloren hatte. Margareta mochte sie nicht. Ihr Vater dafür umso mehr. Er starrte ihr in den immens tiefen Ausschnitt ihres selbst gehäkelten Pullovers und wäre offensichtlich mit seiner fettigen Nase am liebsten zwischen ihre faltigen Brüste gekrochen.
Ihre Mutter holte Margareta einen Stuhl aus der Küche und stellte ihn so hin, dass sie ihrem Vater gegenübersaß. Margareta wusste, wie das nächste Stadium seiner Feiertagsschnapslaune aussehen würde. Krampfhaft würde er in seinem Hirn nach schlüpfrigen Witzen kramen, um sie zum hundertsten Male kundzutun und die Reaktionen der anderen zu testen. Irene Walter würde am lautesten lachen, ja, regelrecht quieken, und sich nach hinten werfen. Und ihr Vater würde immer geiler werden.
Kurz darauf kam es, wie sie prognostiziert hatte. Es folgte ein hohler Spruch aus der untersten Schweinkramschublade ihres Vaters, den er mit feuchter Aussprache in den Raum schrie und Irene grunzte wie ein Ferkel: »Huch, Günther, hä, hä, hä, du bist aber ein ganz Schlimmer!«
Spätestens jetzt hätte sie an ihrer Mutter Stelle die gute Nachbarin an Hals und Kragen gepackt und vor die Tür gesetzt. Ihrem Vater hätte sie die Flasche Ouzo weggenommen. Aber Waltraud Sommerfeld tat nichts, saß nur da, in ihrem unmöglichen gestärkten Kittel, und erduldete mit Gönnerblick das Gockelgehabe ihres Mannes.
Wieso hat man nicht Irene Walter ermordet? Eine so junge Frau musste sterben, und sie darf weiter die ganze Nachbarschaft närrisch machen, dachte sich Margareta.
»Warum bläst du ihm nicht mal den Marsch?«, fragte Margareta ihre Mutter wenig später in der Küche, als sie sich traurig an den Abwasch machte.
»Ach, Kind, du weißt doch, wie er ist. Er meint es nicht so«, verteidigte sie ihren Vater zu allem Überfluss.
»Aber es stört dich doch! Ich finde es widerlich, wie er sich aufführt!« Margareta konnte und wollte ihre Mutter nicht verstehen. Auch als Nur-Hausfrau muss man sich nicht alles gefallen lassen. Bevor sie gleich wieder mit Sprüchen kam wie: ›Ich hatte es bei ihm immer gut und brauchte nie arbeiten zu gehen‹, wechselte Margareta das Thema und kam auf den Leichenfund zu sprechen. Sofort hellte sich das Gesicht ihrer Mutter auf und die Worte sprudelten nur so aus ihrem Mund. Margareta bekam die neueste Zusammenfassung aller Ereignisse und Berichterstattungen der Nachbarn in Kurzform geliefert.
5.
Margareta saß auf dem wackeligen Barhocker in dem dunklen Reiterstübchen und nippte an ihrer Cola, die ihr die Frau mit den langen Haaren soeben hingestellt hatte. Für ihr Alter, Margareta schätzte sie auf Ende 40, war ihre Walla-Walla-Frisur eher untypisch. Ihr Gesicht war sonnengebräunt und hatte feine Züge. Ihre Augen blickten traurig, aber dennoch wachsam. An der gegenüberliegenden Wand hing ein gerahmtes Foto, welches eine strahlende junge Frau in Reitermontur an der Seite eines Pferdes zeigte. Die gleiche Ausgabe Frau in jung. Das musste ihre Tochter Sabine sein, die man ermordet auf dem Friedhof gefunden hatte. Morgen wird sie beerdigt und ihre Mutter bediente hier seelenruhig Gäste. Oder war sie vielleicht gar nicht so ruhig, wie sie schien? Brauchte sie ganz einfach Ablenkung? Und ich? Was habe ich hier eigentlich verloren?, fragte sich Margareta. Mit ihrem frisch gewaschenen Haar, welches ihr locker auf die Schultern fiel, kam sie sich vor wie die Tatort-Kommissarin Lindholm, alias
Maria Furtwängler, die gerade einer heißen Spur nachging. Und diese führte in das kleine, altertümliche Reiterstübchen eines Resser Reiterhofes.
Die dauerwellgelockten Freundinnen ihrer Mutter hatten herausgefunden, dass Sabine Pöschl keine Angestellte des Reiterhofes war, sondern die Tochter des Hauses. Die Pferdenärrin hatte verzogenen Mädchen mit Liebe und Ausdauer Reitunterricht erteilt. Sie war ebenfalls eine leidenschaftliche Reiterin gewesen, die schon so manchen Pokal bei Turnieren eingeheimst hatte.
Wahrscheinlich starrte Margareta die Gläser spülende Karin Pöschl zu sehr an, denn sie blickte misstrauisch zu ihr herüber.
»Sie sind aber nicht von der Kripo, oder? Ich habe genug Fragen in den letzten Tagen beantwortet. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende!«
»Nein, ich bin nicht von der Kripo«, antwortete Margareta nicht ohne Stolz. Man konnte sie also durchaus für eine Kommissarin halten.
»Was wollen Sie dann hier? Ihre Tochter zum Reiten anmelden?«, fragte Sabines Mutter genervt.
»Nein, ich habe keine Kinder. Ich war ganz einfach neugierig, als ich von dem Tod Ihrer Tochter – sie war doch Ihre Tochter, oder? – erfahren habe.« Besser ehrlich sein, dachte sich Margareta. Was hatte sie schon zu verlieren.
»Na, Sie haben Mut! Kommen einfach hier hereinspaziert. Sind gar nicht von der Presse oder Kripo!« Karin Pöschl schüttelte den Kopf, drehte sich um und nahm zwei kleine Gläschen aus dem Hängeschrank mit den Butzenscheiben. Sie stellte sie auf die Theke, griff nach oben in das offene Regal und entnahm ihm eine Flasche Ramazzotti. Seelenruhig schüttete sie die braune Flüssigkeit in die Gläschen und schob eines davon Margareta direkt vor die Nase.
»Auf meine Tochter Sabine!«, prostete die Wirtin ihrem Gast zu und leerte ihr Glas in einem Zug. Welch ein makaberes Verhalten, dachte Margareta.
Karin Pöschl starrte auf die Pokale, die auf der rechten Wand in einem Regal standen. »Alle von meiner Tochter! Reiten war ihr Leben!«
Margareta schämte sich, hier einfach so hereingeplatzt zu sein. Zaghaft nippte sie an ihrem Ramazzotti, dessen Wärme sich sofort in ihrem Mund und wenig später auch in ihrem Magen ausbreitete.
»Wer macht so etwas? Weiß man schon Näheres?«
Karin Pöschl zuckte mit den Schultern. »Ich zermartere mir seit Tagen das Hirn. Die Fragen der Kripobeamten haben Löcher in meine wunde Seele gefressen … Meine Schwiegermutter hält mich für kalt, weil ich weiterarbeite als sei nichts geschehen, mein Mann ist wie versteinert, spricht kein Wort mit mir!«
»Es tut mir leid, dass ich hier einfach so aufgekreuzt bin!« Margareta legte ein Geldstück auf die Theke, bedankte sich höflich und wollte das kleine Reiterstübchen wieder verlassen. Ich bin schon genauso pietätlos wie meine Mutter. Wieso musste ich hierherkommen?
»Dabei hat sie nur Stiefel wegbringen wollen, zur Reparatur. Das hat sie jedenfalls gesagt. Sie wollte sich mit einem Mann auf dem Parkplatz an der Trauerhalle treffen. Er hat da jemanden, der das günstig unter der Hand macht. Man muss ja sehen, wo man bleibt. Doch der hat ein Alibi. Die Stiefel hatte er im Kofferraum. Er hätte ihr nichts getan … sagt er. Danach fuhr sie wohl zu ihrem Freund. Wir wussten gar nicht, dass sie einen hatte. Ein verheirateter Mann.« Mit starrem Blick räumte Karin Pöschl die Gläser weg und wischte die Theke ab. Margareta verließ ohne ein weiteres Wort den dunklen Raum und machte sich klopfenden Herzens zu Fuß auf den Heimweg.
Stiefel zur Reparatur gebracht!
Unter der Hand!
Karol repariert auch Stiefel!
Auf einem Friedhofsparkplatz übergab man Stiefel zur Reparatur. Heiße Ware! Wie Drogen gehandelt!
Woher bekam Karol eigentlich seine Reparaturaufträge? Hat er etwas damit zu tun? Er oder sein Strohmann? Wer war sein Strohmann?
Karol lag bäuchlings auf Margaretas Bett und gab ein zufriedenes Brummen von sich, während Margareta ihm mit dem Zeigefinger seinen muskulösen Rücken entlangfuhr. Es war bereits weit nach Mitternacht, aber sie spürte keine Müdigkeit. Sie war seit ihrem Besuch im Reiterstübchen der Pöschls völlig aufgewühlt. Auch der leidenschaftliche Sex mit dem smarten Polenbürschel hatte sie nicht beruhigen können. Im Gegenteil. Ständig musste sie an die Stiefel denken, die Sabine einem Strohmann übergeben hatte. Zwei Tage später wurde sie umgebracht.
»Karol?«, fragte sie.
»Ja.«
»Woher bekommst du die Schuhe? Wer bringt sie dir?« Sie musste es einfach wissen. Würde ihr die Frage nicht so unter den Nägeln brennen, hätte sie ihn wahrscheinlich heute nicht hineingelassen. Okay, der Sex mit ihm war eine gute Dreingabe, noch mehr interessierte sie allerdings, wie er an die Schuhe kam, die er reparierte.
»Ist doch egal. Wieso willst du das wissen? Hast du mir deshalb die Tür geöffnet? Was soll das?«
Aus dem Radio erklang Caterina Valentes »Sag mir quando, sag mir wann, sag mir quando, quando, quando …«, als Karol wütend aus dem Bett sprang, sich nervös seine Haare nach hinten strich, zum Fenster rannte, das Rollo ein wenig zur Seite schob und hinaussah.
»Natürlich habe ich dich nicht nur deshalb reingelassen. Du bist eine Granate im Bett, komm schon her!« Schalte einen Gang zurück, sagte sie sich. Sie wusste, wie wütend ihr Liebhaber werden konnte, wenn nicht alles nach seiner Pfeife tanzte.
»Sex. Nur Sex. Mehr willst du nicht von mir. Als Mensch interessiere ich dich überhaupt nicht!«
»Oh, nicht wieder die alte Leier. Bitte.« Sie zog ihn an der Hand zurück ins Bett und küsste seine samtigen Lippen. Er stöhnte leise auf und schien ihre Frage vergessen zu haben. Sie kletterte über Karol, um ihm zu zeigen, wer hier die Stärkere war. Nach kurzem Kampf kniete Karol über ihr. Sie zerrte ihre Handgelenke aus seinem Griff und wandte den Blick ab. Dieser kleine Flickschuster, dachte sie wütend.
Bedrückendes Schweigen. Liebevoll küsste er ihr Gesicht. Wenig später reagierte Margareta. Ihre Finger gruben sich fest in seinen Rücken. Sie kamen ein zweites Mal zur Sache.
Als er gegen 2 Uhr in seine Jeans schlüpfte und sich sein Flanellhemd überwarf, zog er sie noch einmal zärtlich an sich. »Ein Mann bringt mir die Schuhe. Er hat mehrere Trinkhallen und nimmt die Reparaturarbeiten an. Dienstags und freitags kommt er. Immer abends.« Aus seinen warmen Augen schaute er sie liebevoll an. »Bist du nun zufrieden?«
»Warum machst du so ein Geheimnis daraus?«
»Ich habe Angst. Ich will nicht entdeckt werden!«
Als sie ihn aus ihrer Wohnung gelassen hatte, lehnte sie sich erschöpft gegen die verschlossene Tür. Nein, Karol hat nichts damit zu tun, sagte sie sich. War sie sich da sicher?
6.
Christel stand bei Ostwind und fünf Grad Minus mindestens eine Stunde hier und starrte wie gebannt auf den winzigen, in der Wiese eingelassenen Grabstein. Ihr Mann Heinz Alshut lag unter dem Rasen eines Gemeinschaftsfeldes, welches an einen Soldatenfriedhof erinnerte. Der Schriftzug des Namens auf der kleinen Steinplatte war das einzig Persönliche, was den Toten von seinem Nachbarn unterschied. Eine ordentliche Gruft hatte er haben wollen, mit richtig schönem Grabstein und toller Bepflanzung. So viel wollte Christel jedoch nicht ausgeben von seinem, wie er immer sagte, ›sauer verdienten Geld‹. Ein Reihengrab wäre sogar günstiger gewesen als die Grabstätte auf dem Gemeinschaftsfeld. Doch da hätte sie sich ein Vierteljahrhundert um dessen Pflege kümmern müssen. Hier in seinem neuen Zuhause war alles im Preis mit drin. Rasenmähen, wann immer es nötig war. Keine saisonale Bepflanzung, kein Blumengießen, nichts. Wenn sie wollte, könnte sie eine kleine Vase neben der Steinplatte in den Boden drücken, mit frischen Blumen darin. Christel wusste nicht, ob sie es ihren Nachbarinnen gleichtun würde und das bescheidene Domizil ihres Göttergatten in ein Blumenmeer verwandeln sollte.
War die innere Zerrissenheit, die sie quälte, eine Phase der Trauer? Heute war sie zum ersten Mal seit der Beerdigung an seinem Grab. Vor ihren Augen spulte sich ein Film ab. Ihr gemeinsames Leben im Schnelldurchlauf. War es ein glückliches Leben, welches sie an der Seite von Heinz 46 Jahre lang geführt hatte? Sie hatten einen Sohn. Friedbert, ihr ganzer Stolz. Außerdem hatte Heinz ihr Sicherheit und Geborgenheit gegeben, für sie gesorgt, wie es so schön hieß. War ihr Ernährer, aber auch ihr Bestimmer gewesen. Das Weib sei dem Manne untertan, galt für Heinz selbst nach Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes im Jahre 1958 und der Änderung des Partnerschaftsgesetzes 1977, nachdem längst die Gleichberechtigung in den meisten Haushalten Einzug gehalten hatte. Oh ja, bei Familienfeiern konnte er große Sprüche klopfen. Emanzipation sei für ihn eine Selbstverständlichkeit. »Nicht wahr, Christel? Bei uns läuft alles partnerschaftlich.« Solange ich alles so gemacht habe, wie er es wollte, dachte Christel wehmütig. Wie sehr hatte sie kämpfen müssen, einen Weg aus ihrer Unselbstständigkeit zu finden. »Lass mal, Christelchen, ich mache das schon, kann ein Mann viel besser.« Das Gefühl, beschützt zu sein, hatte einen hohen Preis.
Jetzt war ihr Gebieter tot. Nun hatte sie die absolute Freiheit. Konnte tun und lassen, was sie wollte. Trotz ihrer 68 Jahre war sie gesundheitlich fit. Und doch fühlte sie sich müde und schwermütig. Das ist die Trauer, du wirst schon sehen, das ist die Trauer, sagte sie sich mehr als einmal.
Es waren ja auch gute Jahre, die Jahre mit Heinz. Obwohl sie damals, als sie mit 22 Jahren geheiratet hatte, sehr schnell von ihrer rosaroten Wolke heruntergefallen und unsanft auf die Erde geplumpst war. Damals, als er ohne ihr Wissen so mir nichts, dir nichts ihren guten Job kündigte. Als sie sich morgens, wie immer, an ihren Schreibtisch setzen wollte, um ihr Tagwerk zu beginnen, war sie unsanft von ihrem Chef angesprochen worden. »Christel, du arbeitest nicht mehr hier! Dein Mann hat gekündigt!« Bittere Vorwürfe hatte sie ihm am Nachmittag, als er von der Schicht nach Hause kam, gemacht. Sie hatte gerne gearbeitet. In ihrem jungen Alter war sie bereits Bürovorsteherin gewesen, mit gutem Gehalt. 350 Mark netto hatte sie verdient.
»Wir können das Geld doch gebrauchen, Heinz«, sagte sie ihm.
»Meine Frau braucht nicht zu arbeiten«, erwiderte er, mit vollem Mund zwischen Frikadellen und Stampfkartoffeln.
»Aber …«, wollte sie aufbegehren.
»Mach das, was deine Pflicht ist und werde langsam erwachsen, basta.« Die Diskussion war für Heinz zu Ende. Wo wäre er denn da hingekommen, wenn seine Christel weiter im Büro gearbeitet hätte? Seine Kumpels auf der Zeche hatten ihn lange genug damit aufgezogen, mit seiner berufstätigen Frau. »Wer hat denn die Hosen bei euch an?«, haben sie gefragt, die Kumpels, in der Kaue nach der Schicht, mit schwarz umränderten Augen, noch nach der Dusche.
Der vorbeiziehende Trauerzug riss Christel aus ihren Gedanken. Sie riskierte einen Seitenblick auf die ausgehobene Grube des Nachbarfeldes. Hier wird also das Mädchen ihre ewige Ruhe finden, dachte Christel. Sie wusste, dass heute die Beerdigung der ermordeten Sabine war. Aus Neugier hatte sie den Zeitpunkt ihres Friedhofsbesuchs so gewählt, um ein wenig der Beisetzung zuzusehen. Christel hatte das Mädchen vom Sehen gekannt. Sie war seit ein paar Wochen im Nachbarhaus ein und aus gegangen. Seit die Frau des netten Nachbarn mit ihren Kindern getürmt war, war Sabine das Liebchen eines verheirateten Mannes gewesen, was Christel nicht guthieß. Obwohl sie Sabine durchaus gemocht hatte. Stets hatte sie freundlich gegrüßt, ihren langen Pferdeschwanz keck nach hinten geworfen, wenn sie aus ihrem Auto gestiegen war. Ein hübsches Mädchen, fand Christel, so anders als all die anderen in ihrem Alter. Was warf sich dieses Naturkind einem verheirateten Mann an den Hals? Mehrmals in der Woche stand sie abends bei ihrem Liebhaber auf der Matte. Ihr Nachbar war mindestens 15 Jahre älter als das Mädchen. Und verheiratet! Und Vater zweier Kinder!
Immer, wenn sie ihrem Sohn Friedbert ihre Bedenken äußerte, schüttelte er nur den Kopf. »Lass die beiden, die sind alt genug«, hatte er stets geantwortet. Er hat ja recht, sagte sie sich.
Unsere Natter sind wir zum Glück losgeworden, dachte sie. Sie hatte Margareta nie gemocht und war froh, als sie oben aus Friedberts Haus auszog. Nie würde sie den Tag vergessen, als ihr Friedbert seine neue Freundin präsentierte. Mit strahlenden Augen, voller Stolz, schob er sie ins Wohnzimmer und stellte sie seinen Eltern vor. Christel spürte sofort, dieses Mal ist es anders. Das ist keine von seinen vielen sporadischen Bettgeschichten, die so schnell wieder vergingen wie ein Schnupfen. Die hier ist ein hartnäckiges Virus, das wir nur ganz schwer wieder loswerden. Und wie recht sie hatte. Drei Jahre hatte der liebe Friedbert unter der Margareta-Krankheit gelitten, bevor sie endlich auskuriert war. Ihr Gatte dagegen hatte die junge selbstbewusste Frau gemocht, die wusste, was sie wollte. Stundenlang konnten sie ausgiebig über irgendwelche politischen Themen diskutieren, miteinander scherzen und herzlich über alltägliche Dinge lachen. Politik hatte Christel nie interessiert. Heinz hatte ihr eingeredet, dass das für eine Frau unwichtig wäre. Eine Frau hat den Haushalt zu besorgen, um alles andere kümmert sich der Mann, war seine Devise. Trotzdem machte es sie wütend, wenn Heinz seinen Charme bei Margareta versprühte wie ein junger Gockel. Die Harmonie zwischen den beiden behagte ihr nicht.
Alle Versuche Margaretas, sich Christel freundschaftlich zu nähern, schlugen fehl. Ihre Interessen waren einfach zu verschieden. Sie hatten sich nichts zu sagen. Margareta fand Christel noch schlimmer als ihre eigene Mutter, und bereits nach wenigen Monaten des Zusammenlebens in einem Haus begann sie, die Frau in der Wohnung unter ihr einfach zu ignorieren.
Anstatt sich zu sagen, akzeptiere die Frau, die deinen Sohn so glücklich macht wie bisher kein weibliches Wesen, unterstützte Christel ihren Sohn sogar, als das alte Fieber bei ihm wieder ausbrach. Das Fieber unterhalb der Gürtellinie, das wie Feuer brannte und nur von unbekannten weiblichen Wesen, welche ebenfalls unter solch einer Krankheit litten, gelöscht werden konnte. Selbst als Margareta, gekränkt durch die Eskapaden ihres Partners, sich Hilfe suchend an Christel wandte und um Unterstützung flehte, ihrem Sohn gut zuzureden, damit ihre Beziehung nicht in die Brüche ginge, zeigte Christel ihr nur grinsend die kalte Schulter. Dabei konnte sie nicht einmal genau sagen, was sie an der Fast-Schwiegertochter so störte, denn eigentlich fand sie diese Frau gar nicht so übel. Christel hasste ihre Freundinnen, die den ganzen lieben langen Tag nur damit verbrachten, auf ihren Schwiegertöchtern herumzuhacken. Sie wollte niemals zu den hassgeliebten Schwiegermüttern gehören. Und dennoch machte sie der jungen Frau das Leben schwer. Vor allem als Heinz zu Margareta hielt, bohrte sich der Stachel der Eifersucht tief in ihr Herz und ließ sie Dinge tun, die gegen ihre Vernunft sprachen.