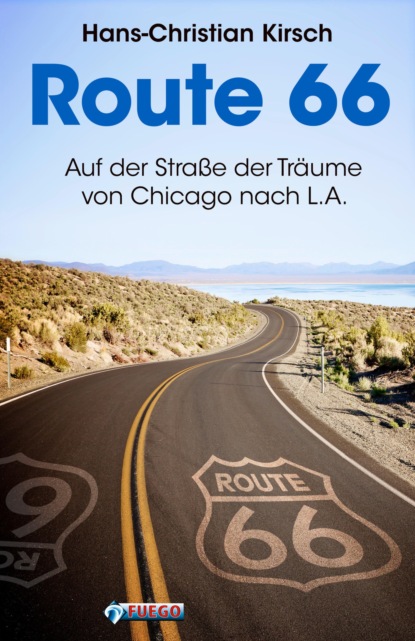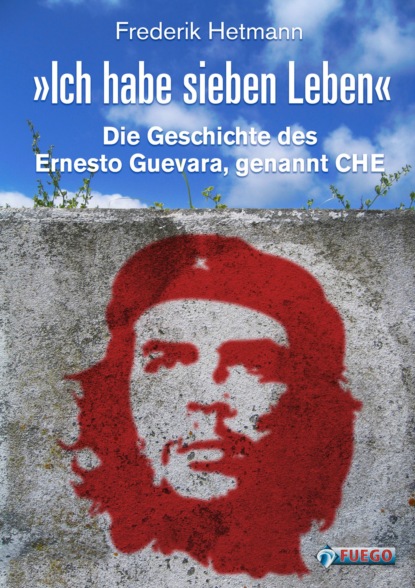
Полная версия:
Frederik Hetmann Ich habe sieben Leben
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
»Raus mit dir!« schimpft Rosa.
»Raus, raus, raus«, echoen die anderen Kinder, froh, dass sich endlich etwas Aufregendes ereignet.
Ernesto schüttelt den Kopf. Er könnte hinausgehen, aber er will nicht. Die Aufregung breitet sich durch seinen Körper hin aus. Er kann nichts dagegen tun. Er sieht die Menschen um sich gestikulieren. Rosas Hand zuckt vor. Ihre Nägel hinterlassen einen Kratzer auf seiner Wange. Immer noch staunt er über soviel Empörung. Die Kinder schieben sich näher heran.
Sie sollen Platz machen, denkt er. Die Luft ist so stickig. Er braucht Platz, um atmen zu können. Seine Hände verkrampfen sich. Er streckt die Arme aus, um die Menschen fortzuschieben.
Sie verstehen das falsch. »... jetzt auch noch unverschämt werden!« Er erhält eine Ohrfeige. Er weiß nicht von wem. Er schlägt zurück.
Der Hustenanfall beginnt. Er hustet, hustet.
»Widerlich«, empört sich Rosa.
Jemand packt Ernesto beim Kragen und versucht, ihn aus dem Salon zu zerren.
Er macht sich steif. Sie sollen ihn in Ruhe lassen, nur einen Augenblick, bis der Anfall vorbeigegangen ist. Er stemmt sich gegen seine Atemnot, verkrampft sich dabei noch mehr.
Don Manuel ist, als er das Geschrei nebenan gehört hat, ärgerlich aufgesprungen und in den Salon geeilt. Mit rudernden Armbewegungen kommt er heran. »Was geht hier vor?«
Man erklärt es ihm.
»Stehen Sie doch nicht so untätig herum«, fährt er Fox an, »tun Sie etwas, schaffen Sie mir den Direktor des Hotels herbei.«
Ernesto erhält einen Fußtritt und stürzt auf den Fliesen im Vestibül nieder. Er spürt nicht mehr, was um ihn herum vorgeht; er sieht nur noch kleine, tanzende Hustensterne vor seinen Augen. Er will um Hilfe schreien. Er ist allein unter den tanzenden Sternen mit diesem Pfeilhagel in seiner Brust und diesem Röcheln.
Als er wieder zu sich kommt, findet er sich lang ausgestreckt auf dem Pflaster vor dem Hotel wieder. Ein rundes, gutmütiges braunes Gesicht mit zerknitterter Haut beugt sich über ihn. Er erkennt, dass es eine Wasserverkäuferin ist. Mit der einen Hand hebt sie seinen Kopf etwas an, mit der anderen versucht sie, ihm etwas einzuflößen.
»Madre mia«, ruft sie aus, als er dankbar lächelt, »er lebt! Der Mutter Gottes sei Dank für ihren Beistand und ihre Hilfe.«
Ein Polizist bahnt sich den Weg durch die Schaulustigen. »Aufstehen«, befiehlt er.
Ernesto versucht es. Er kann sich vor Schwäche nicht allein auf den Beinen halten. Sie müssen ihn stützen. Sie führen ihn zu einer Bank in der Parkanlage gegenüber dem Hotel. Dort schütteln ihn wieder Hustenstöße durch, aber es gelingt ihm, jemandem die Adresse der Eltern zu nennen. Eine Viertelstunde später ist der Vater zur Stelle.
»Wie geht es dir, Sohn?«
»Schon besser.«
»Sie haben dir übel mitgespielt. Wir werden ihnen das nicht durchgehen lassen. Wir gehen jetzt zusammen hinüber zu Don Santamarin. Ich werde verlangen, dass er sich bei dir entschuldigt.«
Aber drüben im Hotel ist die Feier längst zu Ende gegangen. Don Manuel ist mit seinen Kindern und dem Hofstaat schon abgefahren. Der Vater schickt Ernesto heim und macht sich allein auf den Weg zu der Villa der Santamarins.
Später hört Ernesto von anderen Jungen, dass der Vater mit dem Stock eine Lampe zertrümmert hat, ehe ihn die Diener vor die Tür setzten. Solche Geschichten sprechen sich rasch herum. Wer hat gesiegt, grübelt Ernesto?
Eine andere Stadt: Córdoba. Universitätsstadt, voller Studenten, Priester und Nonnen. Die Barockkathedrale auf dem Hauptplatz sieht aus wie ein grauer Elefant. Gegenüber steht das Denkmal eines Generals zu Pferde, in dessen Schatten indiostämmige Rekruten herumstehen und versuchen, mit den Dienstmädchen anzubandeln.
In dem Häuserviereck um den Platz macht sich das Royal-Cinema breit, in das die Kinder aus den reichen Familien zweimal in der Woche geführt werden, um sich einen amerikanischen Kriegsfilm anzusehen, aus dem die Liebesszenen herausgeschnitten worden sind.
Córdoba ist eine träge Stadt, stumpf in ihrer Atmosphäre. Aber hinter der Trägheit und dem Provinzialismus knistern die Spannungen.
Die beiden Cafés an der Plaza sind zugleich die Hauptquartiere der widerstreitenden politischen Parteien. Im »Sol y Luna« treffen sich die Oligarcho-Nationalisten. Sie grüßen mit ausgestrecktem Arm. Keine zehn Schritte weiter liegt das Cafe »Bolo«, in dem sich die spanischen Emigranten zusammenfinden, die nicht müde werden, darüber zu diskutieren, warum in ihrem Land das Volk den Kampf mit dem kleinen, meuternden faschistischen General aus Galizien verloren hat.
«Die deutschen Stukas.«
«Die Russen haben uns im Stich gelassen.«
«Der Terror der Kommunisten gegen die Trotzkisten.«
»Das Waffenembargo der Westmächte.«
Hier sitzt auch Ernestos Onkel Arturo, ein ausgedörrter, kleiner, stets dunkel gekleideter Herr mit einem Kneifer auf der Nase. Er redet nicht mit, hält sich abseits von den anderen. Er schlürft Mate durch ein silbernes Röhrchen, das aufblitzt, wenn die Sonne darauf fällt, macht ein verdrossenes Gesicht, lässt die Mundwinkel hängen und schreibt.
Der Onkel wirkt so ernst und verschlossen, dass es der Junge nie wagt, ihn über diesen Krieg, an dem er teilgenommen hat, auszufragen.
In der Familie ist davon die Rede, dass der Onkel nicht länger mit durchgeschleppt werden könne. Die Guevaras sind nicht zuletzt deswegen nach Córdoba umgezogen, weil ihr Vermögen inzwischen weiter zusammengeschmolzen ist. Ihre Wohnung, in der Calle de Chile, liegt in unmittelbarer Nähe eines Baldio.
Offenbar besitzt der Onkel selbst überhaupt kein Geld. Einmal hat er sich bei Ernesto ein paar Pesos geliehen.
Der Junge bittet im Stillen darum, dass sich jemand finden möge, der dem Onkel so viel Geld schenkt, dass er dort im Cafe »Bolo« sitzen bleiben und weiterschreiben kann. Eines Tages wird man dann lesen können, wie tapfer sich das Volk in Spanien geschlagen hat, auf wessen Seite das Recht war in diesem Krieg.
Die meisten Klassenkameraden von Ernesto ergreifen seit der Belagerung von Toledo für die spanischen Faschisten Partei.
»Oberst Moscardo sieht aus wie ein altes Maultier«, sagt Ernesto.
»Und deine Pasionaria«, höhnt einer seiner Mitschüler, »ein Fischweib ist sie gewesen, und jetzt sieht sie aus wie Rasputin.« Er hat die Lacher auf seiner Seite.
Die Offiziersschule im Alcázar von Toledo verteidigte sich unter ihrem Kommandeur Moscardo im Spanischen Bürgerkrieg vom 18. Juli 1936 bis zum 27. September 1936 gegen eine erdrückende Übermacht republikanischer Verbände. Die Belagerten wurden schließlich von den Verbänden General Francos besiegt.
Bei Ausbruch des Bürgerkrieges war die Pasionaria (Dolores Ibarruri) die bekannteste kommunistische Abgeordnete in den Cortes, dem spanischen Parlament.
Ehe Ernesto im Herbst mit der höheren Schule beginnt, will er drei Monate allein auf dem Fahrrad, das mit einem Hilfsmotor ausgerüstet ist, durch das nördliche Argentinien fahren.
An einem Vormittag, die Ferien haben schon begonnen, putzt er sein Rad auf der Straße vor dem Haus. Nur einen Steinwurf weit fällt die Straße in eine Senke ab. Dort liegen die Baldios.
Durch die Kinderspiele und Träume der Jungen und Mädchen in der Calle de Chile geistert der Mann mit den Hunden, eine Albtraumgestalt, wie aus einer Zeichnung von Goya entsprungen. Er lebt unten in der Senke in einer Hütte mit drei oder vier Hunden zusammen. Der Mann hat beide Beine verloren und fährt jeden Morgen auf einem kleinen hölzernen Wagen, den zwei Hunde ziehen, in die Stadt. Manche Leute sagen, er fahre zu einer Kirche, wo er bettle, andere wollen wissen, er verkaufe Lotterielose. Da es den Hunden jedesmal schwerfällt, die Last den Hügel hinaufzuziehen, ist zuerst immer ein Wimmern und Kläffen zu hören. Dann taucht der Mann auf, mit einem Stock gestikulierend, hochrot im Gesicht vor Wut.
Diese Szene wiederholt sich fast jeden Vormittag. Ernesto sieht von seinem Fahrrad auf, als er wieder das Winseln und Wimmern der geschundenen Hunde hört.
Als der Bettler über den Rand des Hügels gefahren kommt, erscheinen einige kreischende »Baldio«-Kinder, die Steine nach ihm werfen und ihm Schimpfworte nachrufen.
Ernesto ist der einzige Junge; aus den besseren Häusern in dieser Straße, der bei den Kindern aus dem Elendsviertel respektiert wird. Er ruft ihnen zu, sie sollten gefälligst den alten Mann in Frieden lassen. Die barfüßigen Blagen verkriechen sich in ihre Wohnlöcher.
Der Bettler zügelt das Hundegespann. Unmittelbar vor Ernesto bringt er sein Gefährt zum Stehen. Ohne ein Wort zu sagen, blickt er ihn hasserfüllt an. In seinem eisigen Schweigen gibt er ihm zu verstehen, er könne sich seine freundliche Geste ersparen.
Es sind nicht diese barfüßigen Kinder, die er als seine Feinde betrachtet, es sind die Kinder aus den Häusern der wohlhabenderen Leute in der Calle de Chile.
Ernesto unternimmt mit dem Fahrrad die Ferienreise durch die Pampas. Das ist eine Landschaft ohne Städte, mit nur wenigen ausgebauten Straßen, eine Landschaft, in der die Abstände von Siedlung zu Siedlung so groß sind, dass man in den stillen Stunden der Nacht vergebens auf das Gebell von Hunden in der Ferne horcht, eine Landschaft, in der auf einem Gehöft am Morgen der Hahn nur einmal kräht, weil kein anderer Hahn ihm antwortet.
Um die einsamen Häuser haben die Menschen Wäldchen von Eukalyptusbäumen gepflanzt, damit etwas Schatten die Wucht des Himmels, der so unerhört hoch und leer wirkt, dämpft.
Ernesto verdient sein Reisegeld als Gelegenheitsarbeiter. Er kommt auf die Estancias, deren Produkte den Reichtum der Oligarquia in diesem Land begründen: Rinderherden, Weizen, Mais. Er sieht Güter, auf denen es noch kein elektrisches Licht gibt, die kein Telefonkabel mit der Außenweit verbindet. Kleine Staaten für sich! Die Verwalter sind Vizekönige. Die Könige wohnen in Buenos Aires und lassen sich hier draußen höchstens einmal im Jahr sehen, wenn die Erträge gar zu augenfällig zurückgehen.
Ernesto sitzt mit den Peones, den Landarbeitern, zusammen, die in winzigen Schuppen untergebracht sind und siebzig Euro im Monat verdienen. Ihre Familien dürfen nicht mit ihnen zusammen wohnen. Sie bleiben im Baldio der nächsten Stadt, hausen in Wellblechhütten und Erdlöchern, in denen es manchmal noch schlimmer aussieht, als in den Quartieren der Peones zur Erntezeit.
Er hört von den Zuständen in den Kohlengruben der Provinz Jujury. Dort zieht man den Arbeitern die Zeit vom Lohn ab, die sie auf der Latrine verbringen. Keine Luftfilter in den Schächten. Mit 30, 35 Jahren hat der Staub den Männern die Lungen zerfressen. Sie schuften, bis sie tot zusammenbrechen. Sie wissen, wenn sie nicht mehr sind, erhalten ihre Angehörigen noch den Lohn für die laufende Woche, aber keinen Peso mehr. Bettelnd ziehen die Frauen und Kinder dann durchs Land.
Die Zuckerrohrplantagen beschäftigen hauptsächlich Indios. Jeder dritte von ihnen hat Tuberkulose und kaum einer kann lesen oder schreiben. Der Plantagenverwalter hat erklärt: »Um ein guter Zuckerrohrschneider zu sein, braucht man nicht lesen zu können.«
Ernesto müht sich damit ab, einer Gruppe von Indios, die als Wanderarbeiter herumziehen, Zahlen beizubringen, damit sie bei der Lohnabrechnung nicht übers Ohr gehauen werden. Als er am nächsten Morgen aufwacht, liegt er unter freiem Himmel. Sie haben ihm sein Zelt gestohlen und sind auf und davon. Er ist enttäuscht. Wenn sie mich darum gebeten hätten, ich hätte es ihnen geschenkt! Gleich darauf entschuldigt er sie: »Für sie bin ich jemand aus einer anderen Welt.«
Als er von seiner Reise zurückkehrt, sitzt der Onkel nicht mehr im Café »Bolo« beim Mate, vor sich einen Stoß Blätter, die er mit einem Aschenbecher zu beschweren pflegte. Jemand aus der Verwandtschaft hat ihm eine Anstellung als Korrespondent bei einer großen Export-Import-Firma in Buenos Aires verschafft.
Man hat ihn versorgt. Wer wird jetzt die Geschichten aus dem Spanischen Bürgerkrieg aufschreiben?
Die Lehrer in der Oberschule urteilen über Ernesto:
»Er nutzt jede Gelegenheit, um die katholische Kirche anzugreifen, hat marxistische Ideen und ist der Anführer der Linken in der Klasse.«
»Er ist ein hervorragender Schüler. Er sieht älter aus, benimmt sich älter, als er ist. Eine ausgeprägte Persönlichkeit, aber launisch und undiszipliniert: Ernesto setzt sich Ziele, die seine Möglichkeiten weit übersteigen.« Als sich die Mutter wegen einer krebsartigen Wucherung an der Brust einer Operation unterziehen muss, richtet er sich ein Amateurlaboratorium ein und beginnt mit Experimenten an Meerschweinchen in der verrückten Hoffnung, dem Geheimnis dieser Krankheit auf die Spur zu kommen. Eine Zeitlang trägt er sich mit dem Gedanken, ein Lexikon der Philosophie zu verfassen.
Und er verliebt sich. In Chichina Ferreyra. Sie stammt aus einer der reichsten Familien Cordobas. Ihre Eltern besitzen eine große Ranch, zu der Polofelder, Schwimmbäder, ein Gestüt mit arabischen Pferden und ein Musterdorf für die Peones, die in den Kalkbrüchen der Familie arbeiten, gehören.
Chichinas Eltern sind von dem schäbig gekleideten, manchmal schüchternen, dann wieder beißend arroganten Jungen irritiert.
Er selbst fühlt sich bei den Ferreyra unbehaglich. Ein paar Stunden imitiert, ja parodiert er den Konversationston und die Gesten der jungen Leute aus der Oligarquia, dann wird ihm das zu mühsam, und er löscht das vorgetäuschte Image mit einer boshaften Bemerkung wieder aus. Er weiß, er wird einen schlechten Eindruck hinterlassen. Er kann es nicht ändern. Sie sind, wie er nie sein wird.
In vierzig endlosen Liebesbriefen versucht Ernesto, Chichina klar zu machen, was er denkt, was er empfindet.
Da heißt es:
»Die Summe des Elends durch Ausbeutung ist zu groß, die Schuld dieser Klasse, in die Du hineingeboren bist, ist zu groß, als dass ich sein möchte, sein könnte wie sie. Ich verspüre diese Schuld manchmal nachts als einen Albdruck, und selbst Dein Bild, meine Liebste, meine Schöne, vermag nichts dagegen. Der schwankende Knochenturm, der Bottich der Tränen ... verdammt, was sollen diese poetischen Vergleiche! Komm einmal in die Calle de Chile heraus, und wir werden hinuntersteigen in die stinkende Senke. Man muss etwas dagegen tun. Ich kann nicht die Augen davor verschließen. Genauer: ich verschließe die Augen, und ich sehe es trotzdem. Deine Fingerspitzen können meine Lider nicht derart behexen, dass ich diese Bilder vergesse, der Duft Deines Körpers kann nicht aus meiner Phantasie die Anklage verdrängen, die von dem Elendsgestank ausgeht, der aus den Baldios herauf dampft. Reichtum ... nein, ich will keinen Teil daran haben. Ich will keinen Teil daran haben, dass diese Ungerechtigkeit fortbesteht, und wenn ich all das schon nicht ändern kann, so will ich das Leben dieser Ärmsten teilen. Ich will ihre Qualen wenigstens um ein Geringes lindern helfen. Deshalb werde ich Medizin studieren.«
Der unbedingte Idealismus dieses seltsamen Jungen berührt Chichina. Manchmal kommen ihr diese Briefe auch peinlich vor. Immer diese Bilder des Hässlichen! Andererseits schmeichelt es ihr, dass ein solcher Junge gerade sie liebt. Keine ihrer Freundinnen erhält solche Briefe. Zwischen den Zeilen hängt die Aura des Skandalösen. Eigentum, steht da, ist verdinglichte Unfreiheit. - Was soll sie damit anfangen?
Dass sich diese Liebe, abgesehen von ein paar flüchtigen Blicken aus der Ferne, ausschließlich in Briefen äußert, die in die Villa Victoria, das Haus der Ferreyra, hinein- und hinausgeschmuggelt werden, hat seinen Grund darin, dass für das Mädchen und den Jungen keine Möglichkeit besteht, sich zu treffen, es sei denn unter den Augen von Chichinas Eltern, was Ernesto nach den Erfahrungen des ersten Besuchs bei der Familie strikt abgelehnt hat.
Ein Mädchen in diesem Alter aus der Oligarquia ist gut bewacht. Sie besucht nicht die Schule, sondern wird von einer Hauslehrerin unterrichtet. Wenn sie in die Stadt geht, sind die Mutter oder Tanten dabei. Kirche, Theater, Kino - die Hauslehrerin und die Gouvernante begleiten sie. Ernesto nennt das spöttisch: den Geleitzug. Er schlägt Chichina vor, sie solle sich von ihrer Familie trennen. Ein verrückter Plan, den er mit schöner Selbstverständlichkeit entwickelt.
In zwei Jahren wird er die Oberschule beendet haben und zum Studium nach Buenos Aires gehen.
Warum kann sie nicht mitkommen? Sie werden zusammen ein Zimmer nehmen. Er kann mit Gelegenheitsarbeiten so viel verdienen, dass sie beide ihr Auskommen haben.
Sie gibt sich in ihrem Antwortbrief empört. Er bilde sich doch wohl nicht allen Ernstes ein, sie werde mit ihm in einem Liebesnest leben, wie es der Vater für seine Mätresse in der Hauptstadt unterhält?
Ernesto antwortet:
»... immerhin habe ich mit einiger Genugtuung gelesen, dass Du um das Liebesnest Deines Vaters weißt. Es scheint also, dass Mädchen aus den großen Familien doch nicht so wohlbehütet sind, wie es die Konvention erwartet. Bravo, das ist ein Fortschritt! Vermagst Du Dir vielleicht auch vorzustellen, dass unser Liebesnest nicht mit den Federn der Heimlichkeit und den Feigenblättern des Betrugs getarnt, sondern vom Glanz der Reinheit unserer Liebe erleuchtet sein könnte? Und ist es nicht seltsam, dass offenbar jeder eine Liaison Deines Vaters hinzunehmen bereit ist, während das, was ich vorschlage, als empörend und skandalös verschrien wird?«
Sie reagiert hinhaltend. »Ernesto ... ich habe über Deine schlauen Gedanken nachgedacht. Freilich hast Du recht. Du hast meistens recht. Du bist immer so sicher. Ich hingegen, ich weiß nicht, wie ich Dir das erklären soll. Ich fürchte mich einfach, einen solchen Schritt zu tun.
Je t’embrasse Chichina.«
Er erprobt die innere Macht, die er über sie erlangt hat:
»... ich weiß, ich hätte schreiben sollen: keine Widerrede, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werde ich Dich hoch zu Pferde aus dem düsteren Spukschloss derer von Ferreyra entführen. Vergiss nicht, die Silberkette mit der kleinen Madonna aus blauer Jade anzulegen, die ich so gern zwischen Deinen Brüsten tanzen sehe, und stecke ein paar Brillanten zu Dir, damit wir unterwegs nicht am Hungertuch nagen müssen. Ende des Ritterromans. Und nun im Ernst: es ist alles gesagt worden, was es zu sagen gibt. Nein, ich werde diese Entscheidung nicht erbetteln oder ertrotzen. Du musst sie selbst treffen. Wie so viele alte Sprüche stimmt auch jener nicht mehr, dass der Ritter, welcher den Drachen tötet, die Prinzessin heiratet ... oder heißt es die Jungfrau? Ich bin nicht sicher. Einigen wir uns auf ›Prinzessin‹ von wegen der ›pures‹ (Reinheit), die zu akzeptieren mir langsam, ich gestehe es ein, immer schwerer fällt. Verdammt, was ist dabei, schließlich liebe ich Dich. Aber komplizieren wir die ganze Angelegenheit nicht noch mehr. Für den erhabenen Akt nimmt ein Mädchen aus dem Baldig einen halben Peso, so erzählen meine Freunde. Was ich sagen wollte ist dieses: Die Prinzessin muss den Drachen selbst töten.«
Durch einen dummen Zufall fällt gerade dieser Brief Chichinas Eltern in die Hände. Sie sind schockiert. Sie erzwingen von ihrer Tochter die Herausgabe aller übrigen Briefe von Ernesto und nehmen, nach deren Lektüre, den Plan eines Zusammenlebens in Buenos Aires wichtig.
Zwei Wochen später begleitet Chichina ihren Vater auf einer längeren Geschäftsreise nach Mittelamerika und in die USA.
Während der letzten Jahre auf der Oberschule ist Ernesto eng mit den drei Brüdern Granados befreundet. Tomas, der Jüngste, ist sein Klassenkamerad: Alberto und Patricio studieren schon an der Provinzuniversität. Mit Alberto verbindet Ernesto das gemeinsame Interesse an Biochemie und der Erforschung der Tropenkrankheiten.
1944 rufen die Universitätsstudenten einen Vorlesungsstreik aus, nachdem politische Meinungsäußerungen auf dem Campus verboten worden sind.
Alberto wird auf der Straße überfallen und auf das Polizeipräsidium von Córdoba gebracht. Während man ihn in Untersuchungshaft hält, bringt ihm sein Bruder alle paar Tage etwas zu essen in die Zelle. Manchmal kommt auch Ernesto mit.
Alberto versucht, die beiden Besucher dazu zu überreden, einen Protestmarsch der Schüler durch die Straßen von Córdoba zu organisieren. »Wir sitzen hier ohne Haftbefehl. Wir werden keinem Richter vorgeführt. Das sind Tatsachen, die man agitatorisch verwenden kann. Unternehmt etwas!«
Ernesto antwortet: »... sinnlos, auf die Straße zu gehen und der Polizei einen Vorwand zu liefern, uns zusammen zu knüppeln. Nein, Alberto, wenn ich demonstriere, dann nur mit einer Waffe in der Hand.«
1944 ziehen die Guevaras nach Buenos Aires. Der Vater nimmt eine Stellung als Ingenieur an. Er wohnt jetzt bei seiner Freundin. Die Ehe der Eltern ist gescheitert. Ernesto lebt bei seiner Mutter, beginnt mit dem Medizinstudium und hat nebenher noch zwei Jobs.
Er arbeitet täglich sechs Stunden auf der Stadtverwaltung und hat außerdem einen bezahlten Laborantenplatz am Institut für Allergieforschung. Seine Freunde sind darüber erstaunt, dass er Medizin studiert, denn in der Schule hat er sich vor allem bei Mathematik begabt gezeigt.
Seine engsten Freunde, die Brüder Granados, wohnen und studieren weiterhin in Córdoba. Trotzdem reißt der Kontakt zwischen den jungen Leuten nicht ab. Wann immer er es einrichten kann, fährt Ernesto die 600 Kilometer nach Córdoba hinüber, per Autostop oder mit dem Motorrad. Zu reisen, unterwegs zu sein durch das offene Land, das fasziniert ihn.
Seine Freunde und Bekannten nennen ihn wegen seiner Reiselust »Sindbad«. Er erklärt seine Vorliebe damit, dass er unterwegs Hunderte von Menschen trifft, ungezwungen mit ihnen reden kann und Argentinien kennenlernt - sein Land. Auch treten die Asthmaanfälle bei den Reisen seltener auf.
1946 geht Alberto Granados als Biochemiker an ein Leprahospital, 180 Kilometer von Córdoba. Die Entfernung von dort nach Buenos Aires beträgt nun 1.000 Kilometer.
Sobald die Dezemberexamen vorbei sind, packt Ernesto seinen Rucksack, setzt sich auf sein Motorrad und fährt in die Provinz. Unterwegs büffelt er für das Schlussexamen im März.
Anatomie im Straßengraben!
Fast immer macht er auf diesen Fahrten im Leprahospital halt und arbeitet dort einige Tage als Krankenpfleger.
Seinen Kommilitonen in Buenos Aires kommt dieser Guevara seltsam vor. Er erklärt ihnen: »Während ihr daheim lernt, habe ich vor, mich in der Provinz Santa Fé, im nördlichen Córdoba und im östlichen Mendoza umzusehen - die Examen werde ich trotzdem bestehen.«
Er ist kein Student, dem es auf glänzende Noten ankommt. Er betrachtet das Studium als eine Möglichkeit, sich wissenschaftliche Erkenntnisse anzueignen, die ihm für seine idealistischen Lebenspläne nützlich sein können. Er träumt immer noch davon, als Arzt ein Helfer der Armen zu werden. Es ist dies die Konsequenz aus den Beobachtungen seiner Umwelt und dem Willen, seinem Leben einen Sinn zu geben.
Sobald er sein Studium abgeschlossen hat, will er sich als Mitarbeiter in einem der Leprahospitäler oder auf den Pazifikinseln vor der chilenischen Küste anstellen lassen. Wer von den anderen Studenten, mit denen er in den Vorlesungen sitzt, würde für solche Überlegungen Verständnis haben! Die meisten studieren, um als Akademiker einmal zur Oberschicht zu gehören. Sie wollen möglichst rasch ihre medizinischen Kenntnisse in Geld und Besitz umschlagen.
Ernesto möchte irgendwo konkret helfen, etwas von dem Elend lindern, das überall zu finden ist. Und schon jetzt, da er noch davon überzeugt ist, dieser Drang in ihm könne in einer Tätigkeit als Arzt seine Erfüllung finden, ist er radikal.
Er will sich mit den Elendsten unter den Elenden solidarisieren - mit den Aussätzigen.
In Argentinien vollzieht sich in diesen Jahren der vorerst unaufhaltsame Aufstieg des Juan Perón. 1895 in der Nähe von Buenos Aires geboren, in der Armee aufgewachsen und erzogen, hat auf ihn während eines Aufenthalts als Militärattaché in Rom die faschistische Ideologie Mussolinis großen Eindruck gemacht. 1939 ist er nach Argentinien zurückgekehrt und hat als Kommandeur die Anden-Garnison Mendoza übernommen, wo er die GOU gründet, eine politische Gruppe, deren Mitglieder sämtlich Offiziere sind, die sich zum Nationalsozialismus und Faschismus bekennen. Die Abkürzung steht, übersetzt man sie aus dem Spanischen, für Ruhe und Ordnung - Schlagworte, die schon damals ihre Anziehungskraft auf Reaktionäre nicht verfehlten. Nach einem Staatsstreich im Jahre 1943 wird Oberst Perón zunächst stellvertretender Kriegsminister und wacht darüber, dass die Armee im Sinn der GOU-Bewegung und ihres Manifests beeinflusst wird. Im Oktober 1943 übernimmt er zudem noch das Arbeitsministerium und baut sich von hier aus, indem er ihm ergebene Gewerkschaftsführer begünstigt, eine zweite Hausmacht auf. Anfang 1944 lernt Juan Perón bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für die Opfer einer Erdbebenkatastrophe die junge, nicht sonderlich erfolgreiche Schauspielerin Eva Maria Duarte kennen. Juans damalige Geliebte, ein sechzehnjähriges Mädchen, ist verreist. Es fällt Eva nicht schwer, die Konkurrentin auszustechen.