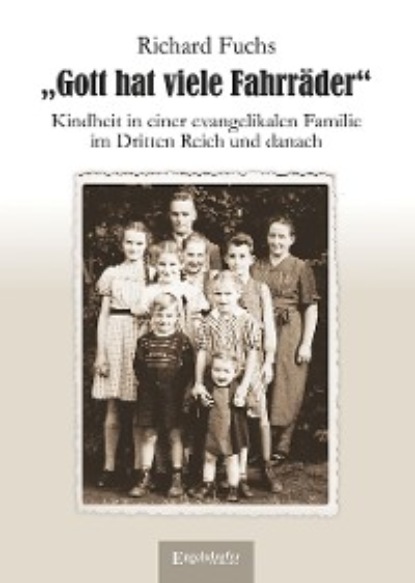
Полная версия:
Richard Fuchs Gott hat viele Fahrräder
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Meine Familie und auch deren Vorfahren gehörten zu einer exklusiven christlichen Glaubensrichtung, die heute unter dem Namen Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde firmiert, früher auch unter Brüderbewegung (Elberfelder Brüder), Darbysten oder Christliche Versammlung, einer Bewegung, die im 19. Jahrhundert in England unter dem Reformer John Nelson Darby (1800–1882) seinen Ausgang nahm. Darby war Aristokrat, Jurist und vormals Priester der anglikanischen Kirche, bevor er dem Pomp der Hochkirche abschwor, sich dem vertieften Bibelstudium widmete und schließlich der geistige Führer und Kopf der Brüderbewegung wurde. Anfangs und im kleinen Kreis traf man sich privat, doch mit zunehmender Mitgliederzahl entstanden Versammlungsräume, oftmals in Hinterhöfen. Im Dritten Reich waren die Gemeinden vorübergehend verboten und ihre Vermögen beschlagnahmt, weil sie mangels straffer Organisation nicht dem Führerprinzip entsprachen und nur schlecht zu kontrollieren waren. In einer Verordnung des Reichsführers der SS hieß es, die Darbysten seien im gesamten Reichsgebiet aufgelöst und verboten, da sie jegliche positive Einstellung zu Volk und Staat verneinten. Als die christlichen Gemeinden unter bestimmten Bedingungen im Bund freikirchlicher Christen (BfC) wieder zugelassen wurden, erklärte ein Teil der Mitglieder sich mit den von oben verordneten Bedingungen nicht einverstanden. Sie sonderten sich ab, gingen in den Untergrund und riskierten sogar Gefängnisstrafen, wenn sie sich trotzdem „unter dem Wort Gottes“ versammelten. 1941/42 kam es zu einem Zusammenschluss zwischen dem BfC und den Baptisten unter der Bezeichnung Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden.
Der Schock des überraschenden Verbots 1937 hielt die christlichen Brüder allerdings nicht davon ab, in aller Naivität für den „Führer, den wir ja alle so lieben“4, zu beten. Dass für den Führer und seine willigen Helfer gebetet wurde, war nicht außergewöhnlich, denn das forderte sogar die Bibel und die musste man in diesen Kreisen wörtlich nehmen. Sie mahnt, für alle zu beten, „die in Hoheit sind“5. Peinlich war nur, dass damals für einen Kriegsverbrecher gebetet wurde, wie später auch in den USA unter anderem für George W. Bush. Wer aber ein offizielles Schuldbekenntnis der Brüder nach 1945 – wie etwa das der evangelischen Kirche – erwartet hatte, sah sich getäuscht. Kein NSDAP-Mitglied wurde später von den Gemeinden ausgeschlossen.6
Kennzeichnend für diese Art der evangelikalen Theologie und Frömmigkeit sind die Zugangsrituale, wie Wiedergeburt durch Bekehrung, persönliche Glaubenserfahrung, Suche nach Heils- und Glaubensgewissheit und schließlich die Erwachsenentaufe. Wer wie ich in einer Familie mit strengem Verhaltenskodex, täglichen Gebeten und Bibellesungen aufgewachsen ist und einer Erwartungshaltung von Seiten der Eltern, sich bereits im Kindesalter zu bekehren, weiß nicht unbedingt, was das bedeutet. Um sicherzugehen, habe ich mich als Kind gleich zweimal bekehrt und wurde von meinem Vater als Halbwüchsiger in einer Badewanne getauft – nicht etwa mit ein paar Spritzern auf den Kopf, wie es bei Babys am kirchlichen Taufbecken geschieht, sondern mit Haut und Haaren ganz unter Wasser, wie es die Bibel lehrt. Die Taufe, in biblischen Zeiten von Johannes dem Täufer am Jordan eingeführt, war ein Novum. Johannes wies damit einen neuen Weg, sich von Sünden reinzuwaschen. Als Jesus von Johannes getauft wurde, hatte er ein ekstatisches Erlebnis. Es wird allerdings nirgends berichtet, dass Jesus selbst von dem magischen Ritus Gebrauch machte, indem er jemanden taufte, obwohl sich der See Genezareth als Arbeitsstätte dazu angeboten hätte. Überliefert ist jedoch, dass Jesus in seiner Abschiedsrede, bevor er emporgehoben in einer Wolke den Blicken seiner Anhänger entschwand, versprach: „Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden“7, was zu Pfingsten dann auch geschah.
Eine mir eng vertraute Person bekannte im hohen Alter, sie habe sich im Alter von neun Jahren zwar bekehrt, aber erst als Siebzehnjährige Heilsgewissheit erlangt. Das erklärt, wie schwierig es für Kinder ist, sich für die Nachfolge Jesu – wie es heißt – zu entscheiden. Eine Bekehrung beziehungsweise Umkehr setzt ja zunächst die Erkenntnis voraus, dass ich nicht so bin, wie ich eigentlich sein sollte. Warum sollte ich sonst umkehren und einen neuen Weg einschlagen? Da Kinder unschuldig geboren werden, ein Kind also im Bewusstsein lebt, es sei eigentlich in Ordnung, muss das Bedürfnis, sich bekehren zu sollen, einen anderen Weg einzuschlagen, durch Erwachsene zunächst künstlich geweckt werden. Man möge mir den folgenden banalen Vergleich verzeihen: Ich war Jahrzehnte in der Werbung tätig. Da gab es Produkte und Dienstleistungen, für die ein Bedarf erst künstlich geweckt werden musste, und zwar durch einen hohen Aufwand an Werbung, damit die Konsumenten von dem Angebot Gebrauch machten. Auf die christlichen Zugangsrituale übertragen, bedeutet das, Kindern muss zunächst ein Schuldbewusstsein implantiert/suggeriert werden, damit die Bereitschaft entsteht, sich zu bekehren.
Ich fragte mich später: Bedeutet Bekehrung, die Ethik, die Jesus lehrte, zu verinnerlichen und danach zu leben, damit eine bessere Welt entsteht, oder im Erwachsenenalter seinem Vorbild folgend zunächst Vater und Mutter zu verlassen, den Tischlerberuf im väterlichen Betrieb an den Nagel zu hängen, Jünger zu animieren, es ihm gleichzutun, um dann bedürfnislos, von Almosen lebend, predigend auf Wanderschaft zu gehen? Die Geschichte, in der die Jünger ihr gewohntes Leben, wie etwa die familiären Verpflichtungen, fristlos und gänzlich aufgaben, um Jesus zu folgen, spiegelt einerseits die Labilität des Charakters solcher Schüler wider, andererseits die Sogwirkung, die von dem charismatischen Lehrer ausging.
Einer, der es Jesus gleichtun wollte – allerdings unter Verzicht einer Schar von Jüngern, aber mit Unterstützung seiner familiären Fan-Gemeinde – war mein Vater, nachdem 1945 seine Existenz als Inhaber eines Schreibwarengeschäfts in Siegen durch Bomben vernichtet war und eine krankheitsbedingte Kündigung ein Intermezzo in einem ihm fremden Beruf beendete. Ab 1949 fühlte er sich berufen, wie Jesus predigend auf Wanderschaft zu gehen. Er war einerseits Prediger in der örtlichen Gemeinde, jetzt im tiefen Westerwald, andererseits Reisebruder, so die offizielle Berufsbezeichnung dieser Freiberufler. Im ersten Fall zum Nulltarif, als Reiseprediger mit einem mäßigen, ungeregelten Einkommen. Das Einstandskapital war die Bibel, die Finanzierung der neunköpfigen Familie von nun an ungewiss.
Nicht erst jetzt waren wir arm. Obwohl ich mir dafür nichts kaufen konnte, war ich aber mit gewissem Stolz The Son of a Preacher Man, wie es 1968 in dem Song von Dusty Springfield heißt. Das verpflichtete zum Wohlverhalten. Jeder Fehltritt seiner sieben Kinder hätte dem Prediger einen Image-Schaden zufügen können, wie etwa die Heirat mit einem Partner einer anderen Glaubensrichtung. Der lange Arm der strengen Erziehung reichte wirkmächtig auch noch bis in die Ferne, als die Kinder weit weg in anderen Städten wohnten und arbeiteten. Gefordert wurde außerdem, vor jeder richtungweisenden Entscheidung zu beten. Da auf direktem Wege keine Weisung von oben einzuholen war, mussten sogenannte Zeichen Antwort geben – mit anderen Worten, eine Art Wink des Himmels.
Von dem für mein Lebensgefühl zu eng gewordenen Gemeindeleben habe ich mich später, im Alter von 28 Jahren, emanzipiert. Was ich gewonnen habe? Eine neue innere und zeitliche Freiheit und die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit elterlichen und geistlichen Instanzen wie deren Lehren. Was mir bleibt, ist das Bewusstsein für eine christliche Ethik der Nächstenliebe, die Anders- oder Nichtgläubige nicht ausgrenzt, nicht missioniert, auch nicht ungefragt bedrängt. Das tat Jesus auch nicht. Er half denen, die freiwillig zu ihm kamen und ihn um Hilfe baten. Er lehrte Gewaltfreiheit und Nächstenliebe, kümmerte sich um Menschen am Rande der Gesellschaft. Man könnte auch sagen: Er war ein Mann in schlechter Gesellschaft, mit Zöllnern und Sündern ohne Berührungsängste. Im Gegensatz dazu haben es Christen jeder Konfession oder Glaubensrichtung immer wieder verstanden, sich abzugrenzen, auf Andersgläubige oder Ungläubige herabzusehen. Bei dem Bemühen, den biblischen Missionsauftrag zu erfüllen, spielen Vokabeln wie du sollst oder wenn du nicht, dann droht oftmals eine entscheidende Rolle.
So sehr der Glaube orientierungsstiftend, lebensspendend und befreiend ursprünglich gedacht war und heute auch noch sein kann, so sehr kann Religion auch destruktiv sein. Sie kann missbraucht werden zur Ausübung von Autorität, Macht, Druck (Gruppendruck) und Gewalt. Die Geschichte des Christentums ist außer allem Positiven auch eine Geschichte der Abspaltung, der Verfolgung und Verteufelung.8 Speziell fundamentalistische Christen haben eine „besonders große Neigung, menschliches Verhalten durch Strafe und Gewalt zu kontrollieren und Konflikte autoritär zu lösen. Sie werten Zwang, Gewalt und deren rechtfertigende Autorität positiv.“9 Das Drehbuch dafür liefert die Bibel in gewissem Umfang selbst mit vielen Beispielen von Gewalt. Was im ungünstigsten Fall für die davon Betroffenen bleibt, sind Zweifel, Minderwertigkeits- und Schuldgefühle, Unfreiheit und Abhängigkeit, bis hin zu Neurosen. Wer kann schon ein Selbstbewusstsein entwickeln, der mit der sogenannten Erbsünde geboren sein soll? Nach meinem Verständnis kann man eher von Erbsünde sprechen, wenn ein destruktives Verhalten der elterlichen Gewalt – das heißt Züchtigung – von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Gott hat viele Fahrräder
Und mögen die Alten auch schelten,
So laßt sie nur toben und schrei’n,
Und stemmen sich gegen uns Welten,
Wir werden doch Sieger sein.
Wir werden weiter marschieren,
Wenn alles in Scherben fällt;
Denn heute da hört uns Deutschland
Und morgen die ganze Welt.
Text aus dem Jahr 1932 von Hans Baumann (1914–1988), Sohn eines Berufssoldaten, seit 1933 NSDAP-Mitglied und Jungvolkführer. Ab 1934 zählte das Lied Es zittern die morschen Knochen zum Standardrepertoire der NSDAP, SA und Hitlerjugend.
Um es gleich vorwegzunehmen: Der Titel des Buches Gott hat viele Fahrräder entspringt nicht dem Hirn eines Kreativen nach einer fiebrigen Nacht, sondern ist ein wörtlich und auch ernst zu nehmendes Zitat aus dem Munde meines Vaters, wie am Ende dieses Kapitels zu lesen ist.
Mein Vater Friedrich Ferdinand Fuchs (1898–1977), verheiratet mit seiner Frau Gretchen, geborene Schwarz (1905–1971), Vater von sieben Kindern, Inhaber eines kleinen Schreibwarengeschäftes in der vor dem Krieg so wunderschönen Kleinstadt Siegen/Westfalen, war ein rechtschaffener, gottesfürchtiger Mann, Mitglied der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, auch Brüdergemeinde genannt. 1928 heiratete er seine um sieben Jahre jüngere Frau. 1933 zog die junge Familie aus dem Ruhrgebiet nach Siegen. Kurz vor Ende des Krieges 1945 rückte unser Vater noch einmal aus – unfreiwillig –, um in sprichwörtlich letzter Minute den Feind, der bereits bis tief ins Ruhrgebiet vorgerückt war, aufzuhalten oder ihn sogar zu besiegen. Vater war 47 Jahre alt. Lust auf das letzte Gefecht verspürte er nicht, wie er auch generell keine Neigung verspürte, als Soldat zu dienen.

Vater im Alter von siebzehn Jahren im Ersten Weltkrieg
Bereits im Ersten Weltkrieg war er als Siebzehnjähriger zur Front in die Vogesen abkommandiert worden. Bis auf ein paar Wehrübungen und Ersatzdienste hatte er sich im Zweiten Weltkrieg dem Wehrdienst – Gott sei Dank – weitestgehend entziehen können. Darüber freuten sich Gretchen, seine Ehefrau, und natürlich auch wir Kinder. Als er eingezogen werden sollte, verwies er auf seinen Kinderreichtum, sieben an der Zahl. Es würde teuer werden für den Staat, wenn er fiele, so die verharmlosende Bezeichnung für den Tod im Gefecht an der Front. Dennoch musste Vater – wie viele andere ältere und junge Männer auch – ganz am Ende des Krieges zum Deutschen Volkssturm ausrücken, obwohl nichts mehr zu retten war.
Zunächst sammelten sich die Siegener Männer und halbwüchsigen Jugendlichen in dem kleinen Dorf Alchen, unweit von Siegen. Dann galt es für Vater und seine Mitstreiter, den Feind im Sauerland aufzuhalten.
Ein Führererlass vom 25.09.1944 sah vor, alle noch in der Heimat verbliebenen Männer im Alter zwischen sechzehn und sechzig Jahren zur Verteidigung des Heimatbodens einzuziehen. Betroffen waren insgesamt sechs Millionen Männer, die bisher aus Altersgründen oder aus beruflichen Gründen verschont geblieben oder noch zu jung waren. Es gab aber Probleme. Neben vielen anderen Mängeln fehlten inzwischen Waffen und Munition, Kleidung und eine Ausbildung. Die Tapferkeit des Einzelnen ließ auch zu wünschen übrig. Es hatte sich längst herumgesprochen, dass der Krieg für die Deutschen an allen Fronten verloren war. Die politische Führung litt an Realitätsverlust und Kadavergehorsam. Gefährlich war das Himmelfahrtskommando dennoch, weil die Männer des Volkssturms Kombattantenstatus10 hatten. Deswegen teilten sie bei Gefangennahme das Schicksal des regulären Soldaten. Es war ein unsinniger und unverantwortlicher Einsatz, der noch viele Menschen das Leben kostete. Zehntausende fielen, 175.000 wurden nach dem Krieg in den Vermissten-Karteien geführt, viele überlebten als Krüppel.11
Bereits am 23. und 24. März 1945 überquerten die alliierten Truppen den Rhein und drangen schnell vom Norden und Süden zum Ruhrgebiet vor. Die Sprengung der Brücke bei Remagen durch die Deutschen hatte nicht funktioniert und so konnten die amerikanischen Streitkräfte den Rhein überqueren, bis die Brücke unter der Last der Panzer doch noch zusammenbrach. Die Rheinfront war damit zerstört. Dennoch ließen die Generäle weiterkämpfen. Aber der totale Zusammenbruch im Westen war nicht mehr aufzuhalten. Was dann folgte, wird als Kesselschlacht bezeichnet und hatte zum Ziel, das gesamte Ruhrgebiet einzukesseln. Das gelang schließlich am 1. April 1945. Am 4. April folgten Angriffe der amerikanischen 9. Armee auf die eingekesselten deutschen Streitkräfte. Im Westen bildete der Rhein die natürliche Grenze und im Süden die Sieg. Eingeschlossen waren über 300.000 deutsche Soldaten und Millionen von Zivilisten in einem durch vorausgegangene Bombenangriffe teils völlig zerstörten Gebiet. Die Strategie der Alliierten war zunächst, den Kessel auf wenige Kilometer zusammenzudrängen und ihn auch noch zu teilen. Das geschah am 15. April 1945 in einer schnellen Operation, vom Süden kommend, durch das Sauerland bis nach Hagen. Dabei gab es etwa 10.000 gefallene deutsche Soldaten, Angehörige des Volkssturms und der Waffen-SS sowie Zivilisten und 1.500 gefallene US-Amerikaner.12 Die Truppen im Ruhrgebiet konnten nur noch aus der Luft versorgt werden. Mit Rückendeckung führender Industrieller, unterstützt von Sozialdemokraten, Kommunisten und anderen regimefeindlichen Gruppen, die nach Jahren der Unterdrückung wieder auftauchten, boten die Bürgermeister verschiedener größerer Städte die Kapitulation an. So fielen Duisburg, Essen, Solingen, Bochum und Mühlheim an den Feind ohne weiteres überflüssiges Leid für die Bevölkerung, die in Kellern, Bunkern und ausgebombten Häusern kauerte und so schon die schlimmsten Entbehrungen zu tragen hatte.13 Im Bergischen Land hatten Mitte April Soldaten ihre Waffen weggeworfen und von der Bevölkerung Zivilkleidung erhalten. Die Alliierten waren unter anderem vom Süden her angerückt.

Vater Fuchs zur Wehrübung 1938 mit Schnauzer. Ein Kommandant hatte gesagt: „Dem alten Mann geben wir den lahmen Gaul.“

Vater Fuchs zur Wehrübung 1939 ohne Schnauzer
Vaters Einsatz endete in Altena, kurz vor Hagen, als sich die Kompanie auflöste. Das war auch das Ende seiner Kriegsdienste. Als am 17. April 1945 die Kämpfe um das Ruhrgebiet endeten und die Lage der Truppen hoffnungslos war, löste der Oberbefehlshaber Feldmarschall Model seine Heerestruppe auf. Eine förmliche Kapitulation unterzeichnete er aber nicht. 317.000 deutsche Soldaten und dreißig Generäle gerieten in Gefangenschaft. Model entfernte sich von der Truppe und erschoss sich wenige Tage später am 21. April 1945 in einem Wald nahe Duisburg.
Vater Fuchs befreite sich von seiner Uniform, lieh sich – offenbar von einem Mitglied der örtlichen christlichen Brüdergemeinde – Zivilkleidung und fand ein herrenloses Fahrrad. Den Anzug gab er später wieder zurück, das Fahrrad nicht, denn er kannte dessen rechtmäßigen Besitzer nicht. Noch während seines Einsatzes beim Volkssturm scheute er keine Mühe, einen Kontakt zu seiner Familie herzustellen. Unsere Tante Lina in Buchen – dem kleinsten Dorf des Siegerlandes, in das wir Kinder nach dem großen Angriff auf Siegen am 16. Dezember 1944 auf Umwegen geflohen waren – berichtet, sie habe einen Brief von unserem Vater in Empfang genommen. Vaters Heimkehr schließlich, ausgerechnet an meinem 8. Geburtstag am 18. April 1945, wurde nicht nur für mich ein unvergessenes Erlebnis. Wie schon gesagt, galten die Kämpfe um das Ruhrgebiet einen Tag vor seiner Heimkehr am 17. April als beendet.14 Das Timing hätte nicht besser sein können. Dank des Fahrrads aus dem großen Fuhrpark Gottes schaffte Vater die Strecke ins Siegerland in nur einem Tag. Dennoch muss es für ihn ein ebenso gefährliches wie mutiges Unternehmen gewesen sein, sich aus dem Staub zu machen. Denn der Krieg war zwar inoffiziell längst verloren, offiziell aber noch nicht beendet, als er nach Hause radelte. Überall konnte der Feind lauern, sowohl der deutsche, als auch der ehemalige Feind, der jetzt für viele Befreier hieß. Zum Glück besaß Vater einen Wehrpass mit einem Entlassungsvermerk vom 13. Dezember 1944, den er bei insgesamt drei Kontrollen vorzeigen konnte. Im Nachhinein verdeutlichen diese Ereignisse einmal mehr den groben Unfug des letzten Einsatzes und das große Glück, unseren Vater, zwar sehr abgemagert, dennoch unversehrt, wiederzusehen.
Da stand er nun ganz unvermittelt, aber pünktlich zu meinem Geburtstag vor der Haustür, ausgestattet mit einer runden, rot-weißen Blechdose Scho-Ka-Kola. Ob zu Wasser, in der Luft oder zu Land an der Front, wo immer Soldaten im Einsatz waren, gab es zusätzlich zur normalen Verpflegung die koffeinhaltige Zartbitterschokolade, sogar noch in der letzten Etappe des Volkssturms. Das im Zweiten Weltkrieg auch als Fliegerschokolade bezeichnete Produkt wurde unter anderem von dem Schokoladenhersteller Sprengel in Hannover hergestellt, der deshalb 1936 als wehrwirtschaftlich wichtiger Betrieb anerkannt wurde. Obwohl Vater sehr abgemagert nach Hause kam, hatte er dennoch die Scho-Ka-Kola als Geburtstagsgeschenk für mich aufbewahrt. Das spricht für Liebe und Fürsorge.
Ich hatte später als Erwachsener zwar noch deutliche Erinnerungen an das Erlebnis als Achtjähriger, bat dennoch meine Tante Lina, mir auf Tonbandkassetten ihre Erinnerungen aus dieser Zeit zu erzählen. Sie war, wie die meisten der vielen Tanten und Onkel des großen Clans unserer mütterlichen Familie Schwarz, eine gläubige, sehr fürsorgliche Frau und konnte gut erzählen.
Die freudige Überraschung der Heimkehr meines Vaters beschreibt sie so: „[…] In dieser Zeit, als ihr bei mir wart, ging ich eines Morgens zur Haustür raus, um im Garten etwas zu ernten. Auf einmal steht dein Vater vor mir. Ich traue meinen Augen nicht. Er lächelte mich an. Wir waren zunächst stumm, und dann fragte ich: ‚Kommst du vom Gretchen?‘ (Mutter Gretchen war noch in Siegen geblieben, d. V.) ‚Nein‘, entgegnete er, ‚ich komme direkt von der Front hierher, weil ich angenommen habe, auch einige von meiner Familie bei dir zu finden.‘ Und wie recht er hatte. Er war mit einem Fahrrad da und stützte sich darauf. Ich frage: ‚Wie kommst du denn zu einem Fahrrad und mit dem hierher?‘ Da lächelt er und antwortet: ‚Gott hat viele Fahrräder, und eins davon gehört jetzt mir. Das hat an einem Wegrand gelegen.‘ Er habe sich wirklich erst umgeschaut, ob da nicht jemand in der Nähe war, dem das Fahrrad gehören könnte.“ Wie Tante Lina weiter feststellt, habe er sehr dürftige Zivilkleidung angehabt.
Das weggefundene Fahrrad schrieb weiter Geschichte. In der Nachkriegszeit – die Wohnung und Vaters Schreibwarengeschäft in Siegen waren zerstört – diente es Vater dazu, fünf Monate lang wöchentlich von Siegen nach Herborn zu seiner neuen Arbeitsstelle zu fahren beziehungsweise ohne Gangschaltung über die Berge zu schieben. Montags in der Früh fuhr er los und samstags kam er wieder zurück, zuweilen bepackt mit einem Sack Kartoffeln auf dem Gepäckträger. Bis ich das alte Fahrrad für mich entdeckte, stand es wenig beachtet auf dem Speicher. Das große Herrenrad war aber viel zu groß für mich. Deshalb trat ich mit einem Bein schräg unter der Querstange in die Pedalen, danach im Stehen über der Stange, bis ich endlich groß genug war, um auf dem Sattel sitzen zu können. Nun hatte ich nicht nur Fahrradfahren gelernt, sondern auch die Erkenntnis gewonnen, dass man mit dem Hinweis auf die höhere Instanz gute Argumente finden kann. Auf Gott war Verlass, vor allem in ausweglosen Situationen. Das wurde uns mit täglichen Bibellesungen und Gebeten zu Tisch und auch abends vor dem Schlafengehen vermittelt.
Das freudige Ereignis von Vaters Heimkehr in Buchen wurde allerdings überschattet von dem Verlust des Mannes meiner Tante Lina. Er hatte an der Front in Russland gekämpft. Obwohl ich jeden Abend für ihn gebetet hatte, er möge doch unversehrt nach Hause kommen, war er gefallen. Während ich ursprünglich guter Hoffnung gewesen war, Gott möge meine Gebete erhören und meine Wünsche erfüllen, war ich nun enttäuscht. Mein Glaube an die Allmacht Gottes bekam kleine Risse. Als Erwachsener wurde mir allerdings bewusst, dass nicht alle menschlichen Schicksale Gott zu verantworten hat, sondern nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip seine irdischen Geschöpfe, denen er den freien Willen gab, zu entscheiden.

Vater Fuchs 1945, abgemagert nach Rückkehr vom Volkssturm
Eine Geburt unter Gottes Beistand
Wir kommen weit her
liebes Kind
und müssen weit gehen
keine Angst
alle sind bei Dir
die vor Dir waren
Deine Mutter, Dein Vater
und alle, die vor ihnen waren
weit, weit zurück
alle sind bei Dir
keine Angst
wir kommen weit her
und müssen weit gehen
liebes Kind
Heinrich Böll an seinen Enkel Samay
Nun bin ich der Geschichte vorausgeeilt, denn mein ereignisreiches Leben begann bereits acht Jahre zuvor, soeben noch in Friedenszeiten. An einem Sonntag um 10:15 Uhr am 18. April 1937 „erblickte unser kleiner Richard unter Gottes Beistand das Licht der Welt“, hieß es in der Geburtsanzeige. „Mutter und Kind geht es gut.“ Ich kam in unserer Wohnung in Siegen, An der Alche 21, zur Welt, während andere meiner Geschwister in der benachbarten Klinik Stähler entbunden worden waren, soweit sie nicht schon in Wattenscheid – dem früheren Wohnort unserer Familie – geboren worden waren.
Meine Eltern nannten mich Richard – ein Name, mit dem ich mich nur zögernd anfreunden konnte. Außer dem einen Namen gab es kein erweitertes Sortiment an Vornamen für eine spätere andere Wahl. Richard soll ein germanischer Name sein und so viel heißen wie mächtiger Herrscher. Einige davon gab es tatsächlich, zum Beispiel in England: Richard I. Wenn damals die Namen der Eltern für die Erstgeborenen bereits verbraucht waren, mussten Tanten oder Onkel als Namensgeber herhalten. Immerhin gab es in der näheren oder angeheirateten Verwandtschaft dreimal den Namen Richard. Einen davon – ursprünglich ein Schmied, später Fabrikant und begnadeter Techniker – habe ich sehr geschätzt und auch er mochte mich. Obwohl aus streng christlichem Haus, blieb Onkel Richard den Gottesdiensten fern. Dennoch praktizierte er das Gebot der Nächstenliebe, indem er den Haushalt seiner verwitweten Mutter mit zwei ledigen Schwestern mitfinanzierte. Er war nicht nur Anhänger der Freikörperkultur, sondern hatte auch eine heimliche Liebe, die er erst heiratete, als seine Mutter gestorben war.